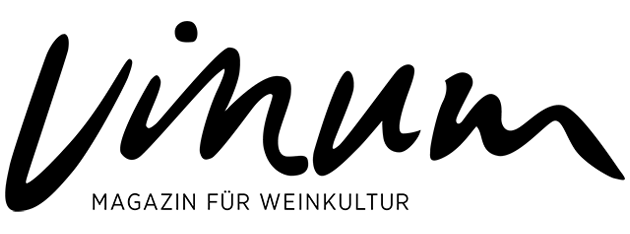Pfälzer Familie Lergenmüller übernimmt Schloss Reinhartshausen im Rheingau
14.02.2013 - R.KNOLL
DEUTSCHLAND (Hainfeld - Eltville-Erbach) - Als die Nachricht vor wenigen Tagen die Runde in der Weinszene machte, dachte mancher an einen Faschings- oder verfrühten Aprilscherz. Dass die Brüder Lergenmüller aus Hainfeld in der Südpfalz das traditionsreiche Weingut Schloss Reinhartshausen im Rheinbau übernehmen, klang etwa so unglaublich wie eine deutsche Fußball-Meisterschaft für Jahn Regensburg. Aber es stimmte: Stefan (48) und Jürgen Lergenmüller (47) sowie Senior Werner (71) sind die neuen Gesellschafter des Betriebes in Eltville-Erbach.
Rechnet man die beiden Betriebe der Lergenmüllers in der Pfalz (zum Gut in Hainfeld gehört noch das kleine Gut Sankt Annaberg in Burrweiler) mit 118 Hektar Rebfläche (80 Hektar Eigenbesitz) und den 76 Hektar im Rheingau zusammen, so dirigiert die Familie damit knapp 200 Hektar. Aber eine Zusammenlegung wird nicht erfolgen. Schloss Reinhartshausen bleibt eigenständig. Jürgen Lergenmüller versichert: „Wir wollen auch das komplette Personal mit 28 Mitarbeitern übernehmen, inklusive Betriebsleiter Walter Bibo.“
Nun werden sich wohl Strukturen ändern und soll vor allem der bisher offenbar nicht optimale Verkauf forciert werden. Angedeutet wird, dass in der Vergangenheit größere Mengen der Reinhartshausener Ernte im Fass verkauft wurden, weil das Gut auf den Märkten nicht besonders stark angesehen ist. Der schon länger in England lebende Nikolaus Prinz von Preußen, ein Abkömmling der Besitzerfamilie, die Reinhartshausen 1855 erwarb, soll als Repräsentant im Exportgeschäft weiter die Fahne der Familie hochhalten, die hier allerdings seit 25 Jahren nicht mehr das Sagen hat.
Zuletzt war das eine Vereinigung von überwiegend gut situierten Leuten, die sich „Freunde von Reinhartshausen“ nennen, aber es scheinbar nicht für gut fanden, dass der Betrieb keine merkliche Rendite, wenn überhaupt, abwarf. Deshalb wurde das Weingut, nicht aber das dazugehörige Hotel (geführt von Kempinski), schon seit einigen Jahren wie Sauerbier auf den internationalen Märkten angeboten. Die Lergenmüllers erfuhren eher zufällig, dass das Haus zum Verkauf stand, überlegten ein Weilchen, fanden dann eine Pfälzer Bank, die sich zur Finanzierung bereit erklärte und schlugen schließlich zu.
Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart, aber man darf von einer nicht geringen zweistelligen Millionensumme ausgehen, da zu Reinhartshausen eine Reihe von Toplagen gehören, in denen Große Gewächse gewonnen werden. Hier liegen die Quadratmeter-Preise zwischen 50 und 70 Euro; bei weniger optimalen, aber immer noch guten Fluren liegt der Durchschnittspreis im Rheingau derzeit bei 5 Euro/qm. Mit übernommen haben die Lergenmüllers auch die gut gefüllte Schatzkammer, in der noch Weine aus dem 19. Jahrhundert liegen. Hier ließ sich Jürgen Lergenmüller den Buchwert entlocken: „Etwa 6,5 Millionen Euro wurden geschätzt.“
Spannend wird es sein, wie der Verband der Prädikatsweingüter (VDP) mit dem Verkauf umgeht. Der Regionalvorsitzende Wilhelm Weil verweist auf die Satzung: „Bei einem Verkauf erlischt zunächst einmal die Mitgliedschaft.“ Danach liegt eine erste Entscheidung beim Bundesverband. Dessen Präsident Steffen Christmann will alles erst mal auf sich und den VDP zukommen lassen. „Wir wollen abwarten, was die Herrschaften machen und werden dann entscheiden.“ Ein Einschwenken auf eine Schiene mit preiswerteren Weinen, auf der man in der Pfalz gut fährt und jährlich 1,6 Millionen Flaschen vermarktet, wird man bei Reinhartshausen sicher nicht für VDP-würdig halten. Und klar ist, dass man es als „unfreundlichen Akt“ empfinden würde, sollten die Brüder weiterhin, wie geschehen, mit „Großen Gewächsen“ aus Burrweiler Lagen operieren. Hier baut Jürgen Lergenmüller schon mal vor: „Diese Bezeichnungen wird es künftig nicht mehr geben.“
Die Vergangenheit sollte bei einer Entscheidung Pro oder Kontra beim VDP keine Rolle spielen. Die Lergenmüllers standen in den neunziger Jahren, als die Konzentration von Most und Wein in Deutschland noch nicht zulässig war, lange Zeit unter Anklage und mussten manche Hausdurchsuchung erdulden. Kollegen hatten sie wegen verbotswidriger Konzentration angezeigt. Ein Beweis wurde nie erbracht, so dass das Verfahren am Ende mit Verhängung einer geringen Geldbuße eingestellt wurde. Die Familie blieb auf Anwalts- und Prozesskosten in sechsstelliger DM-Höhe sitzen. „Seitdem sind wir vermutlich der meist kontrollierte Betrieb in Deutschland“, kann Jürgen Lergenmüller im Rückblick wieder lachen.
Zweifellos stehen sie auch nach wie vor unter Beobachtung einer Reihe von missgünstigen Kollegen, denen das Wachstum und der offenkundige wirtschaftliche Erfolg der Familie nicht geheuer vorkommen. Von der Weinkontrolle erfuhren die Lergenmüllers, dass schon eine Reihe von Anrufen dort eingegangen seien, nachdem der Deal mit Reinhartshausen bekannt wurde.
Auf jeden Fall wird mit dieser Übernahme, die ja letztlich erst zum 1. März 2013 vollzogen sein soll, ein neues Kapitel in der langen, spannenden Geschichte des Weingutes aufgeschlagen. Alles begann Ende des 12. Jahrhunderts, als auf diesen Fluren die Ritter von Erbach und hundert Jahre später die Ritter von Allendorf lebten. 1797 übernahm die Adelsfamilie Langwerth von Simmern. Das Schloss wurde 1801 erbaut. 1855 erwarb Marianne von Preußen, Tochter des Königs Wilhelm I. der Niederlande, das Gebäude mit Grund und machte Reinhartshausen zu einem kulturellen Anziehungspunkt. Weil sie sehr wohltätig wirkte, wurde die Rheinaue mitten im Fluss ihr zu Ehren auf den Namen „Mariannenaue“ getauft (heute ist die langgezogene Insel auf 23 Hektar mit Burgunderreben, Sauvignon blanc und Riesling bestockt und Bestandteil des Weingutes).
Bis 1987 blieb das Schloss Eigentum der Adelsfamilie. Dann erwarb der im Lebensmittelhandel mit Ketten wie Penny und HL reich gewordene Willi Leibbrand das gesamte Areal, investierte vier Jahre lang kräftig in Weingut und Hotel und holte sich 1992 August Kesseler, erfolgreicher Winzer in Lorch, als Betriebsleiter. Kesseler machte aus dem Weingut eine gute Adresse, brachte die Qualität nach oben und konnte das Haus nach dem überraschenden Ableben von Leibbrand (er starb 1993 im Alter von 62 Jahren) fast wie seinen eigenen Betrieb führen.
Das änderte sich, als die Erben Ende 1998 an eine Investorengruppe, die Freunde von Reinhartshausen, verkauften. Schon gut ein Jahr später zog Kesseler die logische Konsequenz aus einer veränderten Politik, zu der auch aufdringliches Telefonmarketing gehörte, und verließ Reinhartshausen noch vor dem Herbst 2000. Danach ging es mit der Qualität bergab. Erst als die Freunde 2003 Walter Bibo als Betriebsleiter aus dem Badischen holten, stabilisierte sich die Qualität wieder und wurde das Potenzial der Lagen besser ausgeschöpft. Es auf noch breiterer Front als bisher zu nutzen, ist das Ziel der neuen Anschaffer.
Zurück zur Übersicht