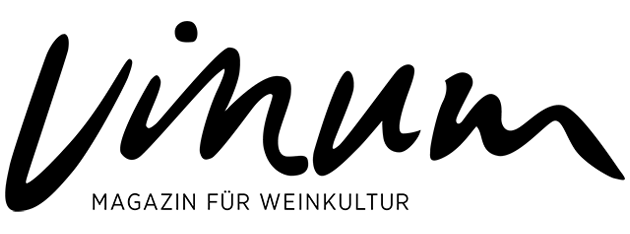Spätfüller
Warten auf die letzte Reife
Text: Patrick Hemminger

Kein Stress, kein Druck, keine Termine: Das Thema Entschleunigung ist beim Wein angekommen. Immer mehr Betriebe verkaufen einige ihrer Weine dann, wenn sie es für richtig halten. Ein Marketinggag oder der bessere Weg? Patrick Hemminger hat recherchiert.
Jugend und Frische sind beim Wein Trumpf. Getrieben von den Wünschen ihrer Kunden bringen die meisten Weingüter ihre Weine so früh wie nur irgend möglich auf den Markt. Das Würzburger Juliusspital ist einer der Betriebe, die bei ihren Topweinen einen anderen Weg gehen.
«Unsere Moste entwickeln eine Kraft, die eigenständige Weine möglich macht. Die Zeit, die sie bekommen, spielt dabei eine ganz grosse Rolle.»
Peter Bernhard Kühn Winzer
Tanja Strätz, die stellvertretende Verkaufsleiterin des Juliusspitals, schiebt sich durch einen engen Gang zwischen 500 Liter fassenden Tonneaux hindurch. In den Händen hält sie zwei Gläser und eine unterarmlange Pipette. Mit ihr entnimmt sie aus dem ersten Fass ein paar Schlucke vom Silvaner, Grosses Gewächs aus dem Würzburger Stein, Jahrgang 2016. Die Grossen Gewächse sind das Beste, was das Weingut zu bieten hat. Sie reifen in einem Raum mit dem Charme eines vollgestopften Kellerabteils. Von der Decke strahlt grelles Neonlicht, auf Paletten stapeln sich Weinkartons, in Regalen stehen Flaschen, eigene und von anderen Weingütern. Dazwischen stehen, ein bisschen wie achtlos hineingequetscht, die zehn Fässer für die Grossen Gewächse. Eine homöopathisch geringe Menge für ein Weingut mit rund 180 Hektar Rebfläche. Die Klimaanlage sorgt für höchstens 14 Grad Celsius und 55 Prozent Luftfeuchtigkeit. Strätz nimmt einen Schluck der Fassprobe. «Sehen Sie jetzt, was der Punkt ist?», fragt sie. «Diesen Wein dürfte ich gemäss dem VDP am 1. September in den Handel bringen.» Einen Gefallen würde sich das Juliusspital damit nicht tun. Denn noch passt bei ihm nichts zusammen. Die Holznoten poltern ungestüm über den Gaumen, Frucht und Säure stehen verloren in der Gegend herum, der Wein ist keine Einheit, sondern eine Vielzahl einzelner Teile. Es hat also seinen Grund, dass das Juliusspital dem Wein ein weiteres Jahr der Ruhe und Selbstfindung gönnt.

Damit ist das Würzburger Weingut nicht alleine. Immer mehr Betriebe haben bei einem Teil ihrer Weine keine Lust mehr, dem Druck des Marktes nachzugeben. Sie verkaufen die Flaschen nicht so bald wie möglich, sondern dann, wenn sie es für richtig halten. Meist sind das zwei Jahre nach der Lese, manchmal auch drei. Dann sind die Weine harmonisch, das Holz ist eingebunden, die Säure seidig und die Primärfruchtaromen haben ihren Rückzug angetreten.

Bis zu drei Jahre reifen lassen
Peter Bernhard Kühn geht mit seinen Weinen noch einen Schritt weiter. Kühn ist 32 Jahre alt und Sohn des legendären Rheingauer Winzers Peter Jakob Kühn. Beide gelten als kompromisslose Qualitätsfanatiker. Der Vater stellte 2004 auf biodynamischen Anbau um und trug durch seine Weine wesentlich dazu bei, die Biodynamie in Deutschland aus der Ecke der Esoteriker und Spinner zu holen. 2012 übergab er die Verantwortung für das Weingut an seinen Sohn. Die Kühns geben ihren Weinen aussergewöhnlich viel Zeit. Bereits die Lagenweine liegen ein Jahr lang auf der Hefe, die Grossen Gewächse zwei Jahre. Weil das bei manchen immer noch nicht reicht, hat das Weingut noch einmal eine eigene Kategorie, die Parzellenweine – die bekommen drei Jahre Zeit. Bei VDP-Betrieben kommen die Grossen Gewächse normalerweise am 1. September im Jahr nach der Lese in den Handel. Entscheidend für die reifenden Weine sind die Arbeit im Weinberg, die gesunden Trauben und die Moste, die daraus entstehen. «Unsere Moste entwickeln eine Kraft, die eigenständige Weine möglich macht. Die Zeit, die sie bekommen, spielt dabei eine ganz grosse Rolle», sagt Peter Bernhard Kühn. Kein Wein wird in ein Schema gepresst und abgefüllt, weil Kunden danach fragen. Allein Vater und Sohn entscheiden darüber. «Im längsten Fall sind das eben drei Jahre von der Ernte bis zur Vermarktung. Diese Zeit ist immer genug für die volle Entfaltung und Entwicklung. Würden wir noch länger warten, ginge es in die oxidative Richtung», sagt Kühn.
Entschleunigung liegt im Trend
Simone Loose hält das Vorgehen der Kühns für klug. Loose leitet das Institut für Betriebswirtschaft und Marktforschung an der Hochschule Geisenheim. «Es macht önologisch gesehen Sinn, mit dem Verkauf eines Weins zu warten, bis er sich öffnet», sagt Loose. Sie sieht diesen kleinen Trend durchaus im gegenwärtigen Zeitgeist. Auf der einen Seite wird alles immer schneller und hektischer, auf der anderen Seite sehnen sich Menschen nach Langsamkeit, Ruhe und den wahren, unverfälschten Dingen – was immer der Einzelne sich darunter vorstellt. «Das ist doch wie bei den Vintage-Jeans. Die werden auf alt gemacht, weil sie erst dann richtig gut aussehen», sagt Loose. Der Trend zu gereiften Weinen geht ihrer Ansicht nach von der Spitzengastronomie aus. Ein Sommelier hat mit gereiften Weinen deutlich mehr Kombinationsmöglichkeiten, da die Aromen komplexer sind. Nicht jeder versteht diese Aromen, weil die meisten Weine jung getrunken werden. Im Restaurant aber haben die Gäste mit dem Sommelier jemanden am Tisch, der ihnen erklärt, was sie da im Glas haben, und damit den Zugang dazu öffnet.

Weinhändler sind gefordert
Dass das nötig ist, erlebt Weinhändler Martin Kössler immer wieder. In seiner Weinhalle in Nürnberg verkauft er seit vielen Jahren Weine abseits des Massengeschmacks. Bio und Spontanvergärung sind für ihn so selbstverständlich wie für andere die Milch im Kaffee. Seine Weine, sagt Kössler, schmecken anders und brauchen Zeit – aber wer hat die heute noch? «Der Kunde würde ja heute schon am liebsten 2018 trinken», meint er. Der Mainstream gibt Fruchtigkeit vor und viele Kunden wissen gar nicht mehr, wie gereifter Wein schmeckt. Dann stehen sie bei Kössler im Laden und sagen, der Wein, den sie vor fünf Jahren bei ihm gekauft hätten, der sei kaputt, der schmecke nicht mehr, der habe einen Korkfehler. «Alles, was nicht Frucht ist, ist für die meisten Menschen Kork», sagt der Weinhändler. Er versucht dann zu erklären, warum der Wein so schmeckt, wie er schmeckt, und warum das richtig ist. Beim gereiften Riesling ist das zum Beispiel eine Petrolnote, andere sind Dörrobst, Kaffeebohnen oder Lakritze. Manche wollen die Flasche dann trotzdem umtauschen, andere freuen sich und bedanken sich, dass sie etwas gelernt hätten.
«Es macht önologisch gesehen Sinn, mit dem Verkauf eines Weines zu warten, bis er sich öffnet.»
Simone Loose Leiterin Institut für Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hochschule Geisenheim
«Schon jetzt haben Winzer Probleme, ihren 15er zu verkaufen. Die Leute kommen zu ihnen und fragen, was das alte Zeug soll», sagt Kössler. Den Kunden macht er dabei keinen Vorwurf. «Aber», sagt er und holt Luft, «wenn wir als Händler das nicht plausibel machen, dann ist das unser Versagen. Wir haben in Deutschland den unprofessionellsten Weinhandel der Welt.» Kössler erklärt, warum er so denkt und was das mit gereiften Weinen zu tun hat. Es geht los mit der Trennung von sogenanntem Naturwein und klassischem Wein. «Schwachsinn», sagt Kössler. In keinem anderen Land gebe es diese Trennung, auch nicht bei den Weinhändlern. «Dieser Paradigmenwechsel von Frucht zu Würze, der Weine schmeckbar unterscheidbar macht, regt viele Winzer dazu an, sich was zu überlegen, auch wenn sie keinen Naturwein machen. Wir Weinhändler versagen da gerade, wir machen diesen Transfer nicht mit, wir erklären das den Kunden nicht», sagt Kössler. So experimentieren die Winzer bei ihren Weinen, die fürs Reifen gemacht sind, mit Maischestandzeiten, Lagerung auf der Vollhefe, verschiedenen Fässern und geringer Schwefelzugabe. Aber statt solche Dinge den Kunden zu erklären, verlasse sich der Weinhandel auf die Punkte von Parker und anderen und habe sich dadurch entmündigen lassen, sagt Kössler. In Frankreich zum Beispiel, da spielen seine Kollegen mit Jahrgängen, legen auch mal was weg. «In Deutschland wird verramscht, weil keiner ältere Jahrgänge kaufen will. Wir müssen viel erklären, den Kunden mitnehmen auf diese Reise», sagt Kössler. Und dabei ehrlich bleiben. Die Weine aus dem Jahrgang 2011 zum Beispiel: «Da gab es Trockenstress im Frühjahr, das war ein Scheissjahr. Die Weine haben deshalb alle einen untypischen Alterungston. Als seriöser Händler muss ich den Leuten sagen, sie sollen jetzt ihre 11er trinken, bevor sie kaputt sind.» Grundsätzlich freut sich Kössler über den Trend, Weine später auf den Markt zu bringen. «Diese Winzer rudern jetzt wieder dahin zurück, wo sie herkamen», sagt er. Früher sass er oft in Verkostungsrunden und bekam viel Gereiftes zu trinken. Die 1970er Jahre waren dabei die schlimmsten, da war alles mager, sauer und dünn. Am besten gefielen Kössler die 1920er Jahre, «die waren richtig gut».
Von den Vorgängern lernen
Das sieht Ralf Bengel genauso. Er ist Kellermeister im Kloster Eberbach und hat den Schlüssel zu einer der am besten gefüllten Schatzkammern des ganzen Landes. Der älteste Wein, der dort liegt, ist von 1706. Aber mindestens genauso wertvoll für seine Arbeit sind die alten Kellerbücher. So können Bengel und seine Kollegen nicht nur probieren, wie Weine aus früheren Zeiten schmecken. Sie können nachschauen, wie die Kollegen vor Jahrzehnten gearbeitet haben. Das war eine unschätzbare Hilfe, als Bengel vor mehr als zehn Jahren damit anfing, langlebigere und haltbarere Premiumweine zu keltern. «Ich war immer wieder beeindruckt, dass alte, trockene Rieslinge erstaunlich frisch schmecken», sagt Bengel. «Und wir haben uns gefragt, wie das geht.» Besonders die Jahrgänge 1920 und 1921 sind noch heute in Topform. Der Kellermeister schaute in die alten Bücher und las, dass seine Vorgänger erst 1924 damit begannen, den 21er abzufüllen. Alle Weine lagen in Holzfässern, Tanks aus Stahl waren damals noch nicht erfunden. Entweder dem Stückfass mit 1200 Litern oder dem Doppelstück mit 2400 Litern. Darauf wollte Bengel aufbauen. «Aber nur Holz zu nehmen, bringt nichts. Man muss das ganze System ändern», sagt er.
«In Deutschland wird verramscht, weil keiner ältere Jahrgänge kaufen will. Wir müssen viel erklären, den Kunden mitnehmen auf diese Reise.»
Martin Kössler Weinhändler
So begann Bengel damit, die alten Kellermeister nachzuahmen. Aus ihren Büchern lernte er, dass die Erträge damals deutlich geringer waren als heutzutage. 25 bis maximal 50 Hektoliter Wein wurden aus einem Hektar Weinberg gekeltert. 50 Hektoliter sind nach VDP-Statuten auch bei einem Grossen Gewächs erlaubt. Dann verlängerte der Kellermeister die Standzeit des Mosts auf der Maische. Bis zu 48 Stunden bleiben nun Schalen, Kerne und Fruchtfleisch in Kontakt mit dem Saft. So gelangen mehr Farbstoffe, Tannine und Extrakte hinein. «Dann verzichten wir auf eine scharfe Vorklärung, der Most kommt deutlich trüber als sonst ins Fass. Die Tannine fangen das Holz ein. Wenn ich zu klar und fein arbeite, dann habe ich einen klaren, feinen Most und der wird vom Holz erschlagen», sagt Bengel. Als Nächstes liegen die Weine ein halbes Jahr auf der Hefe. Dann wird entschieden, welches der fünf Grossen Gewächse von Kloster Eberbach dort bis zu drei Jahre bleibt. Manchmal ist keins dafür geeignet, manchmal mehrere.
2007 war der erste Jahrgang des Steinberger, der erst 2010 auf den Markt kam. «Der ist heute eine Wucht», sagt Bengel. «Natürlich ist das alles ein bisschen retro und passt nicht so recht in die Zeit», fügt der Kellermeister hinzu. Aber es gibt genug Liebhaber, die Geld dafür ausgeben. Wenig ist das nicht. Ein gewöhnliches Grosses Gewächs des Klosters kostet 35 Euro, die gereiften kosten 59 Euro. Viel von dem alten Wissen um diese Weine ist verloren gegangen. Denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag der Weinbau am Boden und es ging erst einmal darum, die Menschen mit Wein zu versorgen. Masse war wichtig, Klasse egal. In den Köpfen der Leute war damals kein Raum für diese Art Wein, weder bei den Konsumenten noch bei den Winzern. «Erst Ende der 1990er Jahre fand langsam ein Umdenken statt», sagt Bengel.
Überzeugungsarbeit war nötig
Auf Gut Hermannsberg an der Nahe macht man es seit dem Jahr 2014 ähnlich. Dort kosten die normalen Grossen Gewächse 30 Euro, die zwei Jahre gereiften 48 Euro. Das klingt auf den ersten Blick nach einem guten Geschäftsmodell. Karsten Peter, Geschäftsführer und Winzer, schränkt das ein. «Von unseren Kunden und den gängigen Weinführern war damals ein gewisser Aufschrei zu hören, weil die Weine nicht da waren. Ich verstehe schon, dass das ein gewisses Problem ist», sagt er. Auch für die Eigentümer des Weinguts. Denn die Weine verschwinden erstmal im Keller und von den Weinkarten der Restaurants, bringen kein Geld und bekommen keine Aufmerksamkeit. Doch Peter gelang es, die Eigentümer von Gut Hermannsberg von seinen Plänen zu überzeugen. Inzwischen lohnt sich das Projekt auch finanziell. Denn nun ist der Betrieb regelmässig mit drei Grossen Gewächsen ein Jahr später dran, der Rhythmus hat sich eingependelt. «Wir machen das nicht, weil wir denken, wir seien die Allercoolsten. Weine vom Schiefer und vom Porphyr brauchen diese Zeit einfach», sagt Peter. Wer ihnen diese Zeit gibt, der wird mit einem besonderen Erlebnis im Glas belohnt. Denn diese Weine sind mehr als nur Rausch, ja sogar mehr als reines Genussmittel. Sie verändern sich über Stunden, sind komplex, machen dabei aber trotzdem viel Spass. Sie schmecken nicht nur einfach nach einer frischen Frucht, sie haben daneben viele Ebenen von exotischen Früchten, Gewürzen oder ganz anderen Dingen wie Olivenöl oder Lederpolitur, die sich im Laufe der Zeit verändern und verschieben. Ausserdem haben die meisten nur um die 12,5 Volumenprozent Alkohol. Das Erlebnis bleibt also auch am nächsten Tag ohne böse Folgen.

Mehrwert für die Gäste
Wer so etwas sucht, dem sei Silvio Nitzsche empfohlen. Der Sommelier betreibt in Dresden die «Weinkulturbar» – Reservierungen für die Abendstunden sind wieder ab 2019 möglich. Nitzsche ist seit langem ein grosser Freund gereifter Weine. Schon im Jahr 2000 bat er Winzer, doch mal ein paar Sachen zurückzulegen. Kaum einer traute sich. Das hatte man noch nie gemacht. Wo sollten die Flaschen denn hin, wer sollte das eines Tages kaufen? So lauteten die Argumente. Dautel aus Württemberg, Diel von der Nahe und Bürklin-Wolf aus der Pfalz waren die Ersten, die Nitzsches Drängen nachgaben. Der Sommelier freut sich, dass das inzwischen immer mehr Weingüter machen. «Der Gast muss im Restaurant oder in der Weinbar doch einen Mehrwert bekommen», sagt er. Und das ist zum Beispiel ein gereifter Wein – inklusive Erklärung. Denn Nitzsche macht wie der Weinhändler Martin Kössler immer wieder die Erfahrung, dass seine Gäste mit dem Geschmack gereifter Weine nicht klarkommen. Er versteht das. «99 Prozent aller Weine werden in den ersten drei Jahren getrunken. Wenn ich jetzt einen gereiften Weisswein bestelle, bekomme ich einen Geschmack, den ich nicht gesucht habe», sagt er.
Oft verstehen seine Gäste diese Weine besser in der Kombination mit Essen. In der «Weinkulturbar» steht viel Käse auf der Karte. Wie gereifter Wein entwickelt Käse mit den Jahren viele und komplexe Aromen. So ergänzen sich die beiden gut und wirken im Zusammenspiel komplexer. Ausserdem lässt sich gereifter Wein auch mit anderen Speisen einfacher kombinieren. «Das sind nicht die besseren Begleiter, aber die sichereren. Weil ich mehr Geschmacksparameter habe als nur Primärfrucht», sagt Nitzsche. Das Frische und Fruchtige verschwindet und macht Platz für getrocknete Pflaumen, Nüsse oder Orangenschalen – die sogenannten Tertiäraromen, die durch die Reifung entstehen.
«Wir machen das nicht, weil wir denken, wir seien die Allercoolsten. Weine vom Schiefer und vom Porphyr brauchen diese Zeit einfach.»
Karsten Peter Winzer
Natürlich lässt sich auch mit jungem Wein Spass haben. «Aber die Frage ist doch: Trinke ich Wein einfach als Genussmittel oder suche ich das Erlebnis im Wein?», sagt Nitzsche. Das findet er am ehesten in gereiften Weiss- oder Grauburgundern. Im Gegensatz zu gereiften Rieslingen oder Silvanern böten diese Rebsorten mehr Überraschungen. Viele machen mit diesen Weinen den Fehler, dass sie sie aufmachen, einschenken und in kurzer Zeit trinken. Dabei entgeht ihnen eine Menge. Diese Weine brauchen Zeit, sich zu akklimatisieren und zu entfalten. Klar kann man sie dekantieren. Aber dann gehen so viele Sequenzen verloren, die die Weine im Glas nur langsam durchlaufen. «Ich würde das erstmal für mich alleine machen, dass ich mir nichts von anderen vorgeben lasse», sagt Nitzsche. Er nennt das «sich der eigenen Empfindsamkeit hingeben».

Pionier will es nochmals wissen
Ein Satz, der Bernd Philippi gefallen könnte. Der Pfälzer sitzt auf seinem Weingut in Portugal, schnarrend kommt seine tiefe Stimme durch das Handy. Im Hintergrund bellt ab und an ein Hund oder kräht ein Gockel. «In zwei Kilometern Umkreis ist hier gar nichts. Das ist ein Ort der Ruhe. Früher bin ich ja rumgerannt wie ein Huhn ohne Kopf», sagt er. Früher, das war, als ihm das Pfälzer Weingut Koehler-Ruprecht gehörte. Das war, als «Der Spiegel» 1996 über ihn schrieb, dass alle Welt zum Weinkaufen zu ihm nach Kallstadt wolle, er ein Weinverrückter, ein Künstler ein rebenvernarrter Spinner sei. Dabei machte Philippi nichts anderes als das, was heute die meisten Spitzenbetriebe machen. Nur war er damit 15 Jahre früher dran. Penible Weinbergsarbeit, selektive Handlese, keine Reinzuchthefen. «Als ich den Betrieb 1986 von meinem Vater gepachtet habe, war dieser Weinstil nicht so geschätzt. Heute wollen ihn viele nachahmen», sagt er. Philippi sieht seine jungen Kollegen trotzdem kritisch. Zu viele lassen sich seiner Meinung nach von den Wünschen der Kunden treiben. Früher seien die Weine individueller gewesen, man habe ihnen einfach mehr Zeit gelassen. Er liess seine Weine schon damals machen, was sie wollten. Im Herbst, wenn es kühl wurde, hörten die meisten auf zu gären. Im Frühjahr machten sie irgendwann damit weiter. Mindestens bis kurz vor der nächsten Lese lagen die Weine in ihren Holzfässern. Das hatte einen praktischen Grund, Philippi wollte die Fässer so kurz wie möglich leer lassen. Aber gefiel ihm ein Wein nicht, gab er ihm immer die Zeit, die er brauchte. Keiner musste in die Flasche, ohne dafür bereit zu sein.
«Als ich den Betrieb 1986 von meinem Vater gepachtet habe, war dieser Weinstil nicht so geschätzt. Heutewollen ihn viele nachahmen.»
Bernd Philippi Winzer
2009 verkaufte er das Weingut Koehler-Ruprecht und ist etwa die Hälfte des Jahres unterwegs, entweder in Portugal oder sonst wo in der Welt. Trotzdem lässt ihn seine Lieblingslage in der Heimat nicht los, der Kallstadter Saumagen. «Die ist so grossartig, ich ärgere mich, was die jungen Winzer zum Teil daraus machen. Ich habe alle aktuellen Saumagen probiert. Auch grosse Namen waren totale Scheisse. Das ist alles nur auf Profit ausgerichtet. Auf möglichst schnellen Profit.» Philippi will es den jungen Kollegen nochmal zeigen. Ihm gehören wieder ein paar Rebstöcke im Saumagen. 10 000 Flaschen will er machen, einfach nur so. Und auf die alte Weise. Mit Zeit. Denn ein bisschen mehr Zeit kann in der Flasche einiges verändern. Die Aromen werden vielfältiger, der Wein wird einzigartiger. Fast wie beim Menschen, der mit den Jahren nicht frischer, aber interessanter wird.