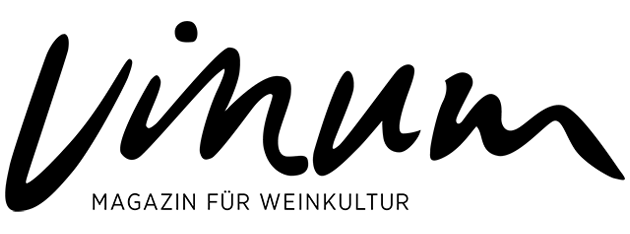Bioweinbau Schweiz
Und täglich grüsst Utopia
Text: Dominik Vombach, Fotos: Patrick Rey
Wer in der Schweiz ökologischen Weinbau betreibt, ist Idealist. Irgendwo zwischen traditionellen Anbaumethoden, neuen Piwi-Sorten und «Klimafarming» liegt die Zukunft des Schweizer Bioweinbaus. Welcher Weg ist der richtige?
Das Walliser Weingut Mythopia könnte man als Auroville des ökologischen Weinbaus bezeichnen. Wie die von Hindu-Guru Sri Aurobindo gegründete Zukunftsstadt im Südosten Indiens ist auch Mythopia die realisierte Vision einer optimalen Lebensgemeinschaft. Nur besteht die Lebensgemeinschaft auf 750 Metern über dem Meer nicht ausschliesslich aus Menschen. Lebewesen aller Art, Pflanzen, Einzeller bilden ein gesundes, funktionierendes Ökosystem. Mittendrin der Sri aus dem Wallis – Hans-Peter Schmidt.
Auroville, so heisst es in den Statuten, möchte «die Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft» sein. Auf Mythopia scheint dies schon gelungen. Während das Alpenglühen die Gipfel rundum einnimmt, ziehen Dutzende Insekten ihre letzten Runden durch die üppig begrünten Rebzeilen und das Buschwerk rundum. Bläulinge, Hummeln und Wildbienen saugen den Nektar von unzähligen blühenden Wildkräutern und Wildblumen. «Unkräuter» gibt es auf Mythopia nicht. Genauso wenig die Angst davor, dass andere Pflanzen den Rebstöcken das nötige Wasser nehmen könnten. Schon ein paar Grashalme am falschen Örtchen treiben manchem Winzer Angstschweiss auf die Stirn. Tomatenstauden, Pfirsichbäume und Erdbeeren zwischen den Reben, hier auf Mythopia Standard, würden bei diesen Winzern zum Herzstillstand führen. Selbst ökologisch arbeitende Produzenten, die üppig begrünte Weinberge ihr Eigen nennen, empfinden diesen Anblick als surreal. Der erste Besuch auf Mythopia ist wie der erste Zug an einer Zigarette – gewöhnungsbedürftig.
Klimafarming im Weinberg
Vieles, was auf den fünf Hektar von Mythopia geschieht, entspricht nicht dem, was ein Winzer während seiner Ausbildung lernt. Selbst der Boden ist nicht gewöhnlich, sondern dunkler als in den Weinbergen der Nachbarn. Auf den zweiten Blick erkennt man feine Kohlestückchen darin. Nicht irgendeine Kohle, sondern Pflanzenkohle. Ein Stoff, der durch das Verschwelen von Grünschnitt, Trester oder anderen organischen Materialien unter Sauerstoffausschluss gewonnen wird. Pflanzenkohle wurde schon vor Jahrtausenden von Indios zur Bodenverbesserung eingesetzt. Terra Preta (portugiesisch für schwarze Erde) machte die unwirtlichen Böden des Amazonasbeckens fruchtbar und sicherte das Überleben der indigenen Stämme. Schon vor Jahrzehnten geriet die Wundererde deshalb in den Fokus der Wissenschaft. Dass Pflanzenkohle langfristig klimaschädliches Kohlendioxid binden kann, also sogenanntes Klimafarming ermöglicht, entdeckten Forscher Ende der 90er Jahre. Ein Forschungsbereich, der für Hans-Peter Schmidt immer wichtiger wird. Das zu Mythopia gehörige Ithaka-Institut (vormals Delinat-Institut) beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Potenzial der Pflanzenkohle.
Im Jahr 2009 gründete Delinat das Institut als gemeinnützige Stiftung. Die Forschungstätigkeit sollte dabei helfen, Strategien für ökonomisch tragfähige, klimaneutrale Landwirtschaft mit hoher Biodiversität zu entwickeln. Ein Glücksfall für beide Parteien. Hans-Peter Schmidt hatte wichtige Vorarbeit in den Rebbergen von Mythopia geleistet und konnte durch Delinat mit einem beruhigenden finanziellen Polster im Rücken forschen. Der Bioweinhändler erarbeitete mit Schmidt zusammen neue Richtlinien für Winzer in ganz Europa. Schmidts «neuartige» Ansätze, speziell jene zur Biodiversitätssteigerung im Weinbau, wurden auch in die Demeter-Richtlinien aufgenommen. Kein Wunder, denn seiner Ansicht nach kann nur durch artenreiche Begrünung und die Ermöglichung symbiotischer Prozesse eine komplexe Pflanzenernährung stattfinden. Eine Voraussetzung für optimale Traubenqualität – etwas, wonach jeder Winzer streben sollte. «Die Zeit war reif für Biodiversität», sagt Schmidt.
Im letzten Jahr löste Delinat die Zusammenarbeit auf. Eine Situation, die in den ersten Monaten vor allem finanziell schmerzte. Heute gleicht man die fehlenden Mittel durch eine Spezialisierung auf das vielversprechende Klimafarming aus. Zu den Kunden des Ithaka-Instituts gehört unter anderem die Europäische Union.

Zukunftsmusik aus dem Wallis
Hans-Peter Schmidt wuchs in Dresden auf, studierte Philosophie und Film in Hamburg, lehrte an verschiedenen Universitäten und wurde von heute auf morgen Winzer im Wallis. «Das war keine bewusste Entscheidung, wie so oft im Weingeschäft», sagt er. Wir schreiben das Jahr 2004, als Schmidt mit seiner Frau, einer gebürtigen Walliserin, in deren Heimatkanton zieht. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigt er sich mit dem Untergang verschiedener Hochkulturen und damit, wie man Ökosysteme so stabilisiert, dass kein Untergang droht.
Weinmachen lernt er vom Schwiegervater, der schon immer im Nebenerwerb Trauben produzierte, wie so viele im Wallis. Schmidt hinterfragt von Beginn an das Weinmachen an sich. Braucht es all die Behandlungsmittel wirklich? Schritt für Schritt lernt er, welche Mittel er weglassen kann. Übrig blieb nichts, auch kein Schwefel. «Man muss den Wein verstehen, und das funktioniert auf die Naturweinart am besten. Natürlich lässt sich ohne Schwefel kein restsüsser Kabinettwein herstellen, aber jeder Winzer sollte zumindest einmal auf diese Art arbeiten, um zu erkennen, welches Potenzial in seinen Weinen steckt.» Schmidt machte schon damals Naturwein, und nur wenige wussten mit den ungewöhnlichen Tropfen umzugehen. Naturwein sieht er als Chance für Biowinzer, um im Topsegment für Furore zu sorgen und sich zu etablieren.
Die Biozertifizierung ist für Schmidt selbstverständlich. «Das Biolabel ist für mich mehr Marketinginstrument als Qualitätssiegel. Eine Bestätigung für meine Kunden, dass ich tatsächlich ohne chemisch-synthetische Dünger und Pestizide arbeite.» Warum sich so viele Winzer gegen die Zertifizierung und Kontrolle entscheiden, versteht er nicht. «Zeit und Geld können es jedenfalls nicht sein», sagt Schmidt. «Viel lieber wäre mir natürlich, wenn sich die konventionell arbeitenden Winzer zertifizieren lassen müssten. Die sind es ja, die Gift spritzen.» Schmidt wünscht sich, dass alle Winzer so arbeiten wie er auf Mythopia – und das ganz ohne Zertifizierung, aus reiner Überzeugung. Sind die Mythopia-Methoden die Zukunft des Schweizer Bioweinbaus oder gar der ganzen Welt?
Philip Gallati, Rebmeister des Weinguts FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) in Frick, kennt die Probleme der Schweizer Biowinzer. Hohe Niederschlagsmengen machen ein effizientes Arbeiten mit Europäerreben, also Sorten wie Pinot Noir oder Müller-Thurgau, ausserhalb der Westschweiz kompliziert. Es braucht in schwierigen, warm-feuchten Jahren viel Kupfer zum Schutz gegen Pilzkrankheiten. «Für einen Winzer, der so ökologisch wie nur möglich arbeiten möchte, ist diese Situation unbefriedigend», sagt Gallati. Was bleibt, ist die Umstellung auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten (Piwi).
Interspezifische Sackgasse
Sorten mit so kryptischen Namen wie VB 91.26.04 versprechen eine gewisse Resistenz gegen Pilzkrankheiten. Im Idealfall kann der Winzer ganz auf Kupfer verzichten und auf Tonerde umsteigen. Beim Weingut FiBL wird dies seit Jahren erfolgreich praktiziert. Einziger Haken an den Neuzüchtungen ist der Wein. Weisse Sorten wie Johanniter sind unkompliziert, bei den roten Sorten aber muss der Winzer in die önologische Trickkiste greifen, um dem «interspezifischen Loch» die Stirn zu bieten. Letzteres bezeichnet die natürliche Strukturschwäche roter Piwi-Weine. Sie enden am Gaumen oft mehr als abrupt. Barriques und der Verschnitt mit gängigen Rotweinsorten können Abhilfe schaffen und verleihen den Weinen das notwendige Gerüst. Dann machen auch die Rotweine richtig Spass. «Wer jedoch glaubt, aus einer Cabernet-Züchtung einen grossen Wein im Stile eines Bordeaux schaffen zu können, liegt daneben», sagt Gallati.
Weinliebhaber sträuben sich förmlich gegen die Piwi-Gewächse, wohingegen sie bei Weineinsteigern aufgrund ihrer Unkompliziertheit sehr gut ankommen, weiss der FiBL-Rebmeister. Für ihn ist der Konsument ein entscheidender Faktor. Günstige Bioweine aus Spanien oder Italien gibt es zuhauf in ordentlicher Qualität im Supermarkt um die Ecke. Jene aus der Schweiz seien zwar nur wenig teurer als ihre konventionell produzierten Pendants, haben es beim Konsumenten aber genau wegen iher Herkunft schwer. Das Verhältnis zwischen Qualität und Preis wird stärker hinterfragt. Biolabel, Regionalität und das damit verbundene gute Gewissen scheinen bei Wein offenbar weniger entscheidend zu sein. Der günstige Bio-Tempranillo aus Spanien schmeckt einfach, und das macht den einen oder anderen Konsumenten neugierig – aber ein Schweizer Bio-Pinot-Noir muss für den vergleichsweise hohen Preis schon hervorragend schmecken, damit der Konsument auch hier zugreift.
Industrie oder High End?
Ist es Schweizer Biowinzern überhaupt möglich, ihre Produkte bei aller Mühseligkeit im Anbau zu einem guten Preisa nzubieten? Auch Biowinzer sind darauf angewiesen, möglichst wirtschaftlich zu arbeiten. Wie eine technisch und letztendlich auch wirtschaftlich optimierte ökologische Produktion aussehen könnte, zeigen Versuche in Freiburg im Breisgau. Pilzwiderstandsfähige Rebsorten werden im dortigen Versuchsweinberg im Minimalschnitt, einer speziellen Reberziehungsmethode, angebaut. Die lässt die Reben etwas struppig aussehen, hat aber den Vorteil, dass die Laubarbeiten minimiert werden können. Am Ende rollt in Freiburg der Vollernter durch den Weinberg. Ist es fortschrittlich, wenn Winzer effizienter und ökologischer, gleichzeitig aber auch mit industriellen Hightech-Methoden arbeiten? Industrialisierter ökologischer Weinbau – ein Szenario, das wenig mit den blumigen Vorstellungen vieler Konsumenten gemein hat. Und doch wird dieses Tabu tagtäglich an der Supermarktkasse gebrochen, denn irgendwer kauft sie ja, die günstigen, industriell produzierten Bioweine aus Südeuropa.
Die industrielle Bioweinproduktion ist in der Schweiz laut Philip Gallati aufgrund der topographischen Verhältnisse schwer bis gar nicht möglich. Ein Szenario, das uns also wohl erspart bleiben wird – aber wohin führt die Zukunft? «Die hohen Preise für Schweizer Biowein lassen sich nur durch entsprechend hohe Qualität rechtfertigen», sagt Hans-Peter Schmidt. Gleichzeitig muss die Glaubwürdigkeit gegeben sein, ergänzt Gallati, und die lässt sich heute und auch in Zukunft nun mal nur durch eine Biozertifizierung erreichen. High-End-Biowein aus der Schweiz als Alleinstellungsmerkmal? Blicken wir noch einmal ins Wallis zu Mythopia, wo die Zukunft näher zu sein scheint als anderswo in der Schweiz. Die Weinberge strotzen nur so vor Biodiversität, die Böden lassen eine komplexe Pflanzenernährung zu, und im Herbst erntet der Winzer perfekte Trauben. Gewirtschaftet wird möglichst klimaneutral. Pflanzenkohle speichert das Kohlendioxid aus der Atmosphäre – damit der Winzer selbst nur ein Mindestmass an Kohlendioxid ausstösst, kommen elektrisch angetriebene Rebbaumaschinen zum Einsatz. Pflanzenschutzmassnahmen sind im Weinberg der Zukunft effizient und selten. Vielleicht findet sich schon bald ein Mittel, das effizienter als Kupfer ist. Phosphit etwa besitzt dieses Potenzial und wird gerade von der EU auf Zulassung geprüft.
Im Keller der Zukunft lässt der Biowinzer die Dinge kontrolliert geschehen. Die Weine sind natürlich, ungeschminkt und ehrlich. Eine Vorstellung, die auch Gallati realistisch erscheint. Er sieht die Zukunft als eine Mischung aus Piwi-Rebsorten und High-End-Naturweinen – Piwi-Rebsorten als Basis für die einfachen Brot-und-Butter-Weine und High-End-Naturweine für die anspruchsvollen Freaks. Vielleicht stehen die Schweizer Biowinzer bereits mit einem Fuss in der Zukunft.