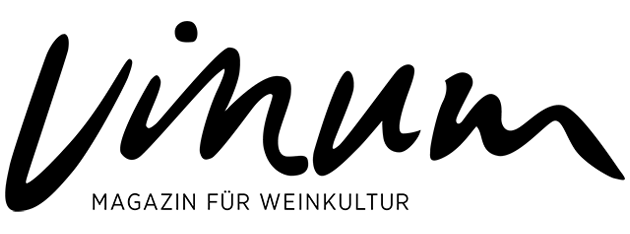Interview mit Jean-Paul Schwindt
Der Erfolg hängt von allen Akteuren ab
Text: Anick Goumaz, Foto: z.V.g.

Wird die Qualität von Schweizer Weinen international gebührend anerkannt?
Die von unseren Winzern seit den 1990er Jahren unternommenen Anstrengungen zur Verbesserung unserer Weine hat zu weltweiter Anerkennung geführt, allerdings von einem recht kleinen Kreis. Er setzt sich aus Experten, Fachleuten und Liebhabern feiner Weine zusammen, die in der Verkostung geübt sind. Nur reichen «Qualität» und Medaillen nicht mehr aus, um den internationalen Durchbruch zu schaffen. Weil auch die anderen an Qualität gewinnen, wie z. B. die Weine der untersten Preisklasse aus Burgund.
Warum ist der Exportanteil so niedrig?
Innerhalb von dreissig Jahren stiegen wir von 0,8 % des jährlichen Produktionsvolumens auf eine Rate, die seit einiger Zeit bei 1,5 % stagniert. Der ersehnte positive Kreislauf des Wachstums blieb leider aus. Mit dieser Underperformance sind wir weder auf dem weltweiten noch auch nur auf dem europäischen Radarschirm. Vor diesem Hintergrund ist es äusserst schwierig, auf einer so geringen Grundlage irgendeine Hebelwirkung auszuüben.
Ist der Export die Zukunft des Schweizer Weins?
Alle grossen Länder, die im Ausland erfolgreich sind, haben eine Gemeinsamkeit: Sie verfügen über eine dominante Position auf ihrem eigenen Markt und der Export ermöglicht es ihnen, ihre Basis zu stärken und ihr Profitabilitätsniveau insgesamt zu erhöhen. Das geht in die eine Richtung, aber nicht in die andere. Die Expertise im Weinbau, der Ruf der Weine und ein effizientes Produktionssystem müssen zunächst auf dem einheimischen Markt erlangt werden, um den Status eines Weinlandes zu erreichen, der die Türen zum Export öffnet. Nehmen wir zum Beispiel Österreich, ein vergleichbares Land, das uns in Bezug auf die Bevölkerungszahl nahesteht. Im Jahr 2021 haben österreichische Weine ihren eigenen Exportrekord gebrochen und ein Volumen von 70,2 Millionen Litern (Schweiz: 1,3 Mio.) erreicht, die zu einem Durchschnittspreis von weniger als 3 €/Liter verkauft wurden! Mit einer Jahresproduktion von 250 Millionen Litern (Schweiz: 90 Mio.) wird die kritische Grösse in Bezug auf den Skaleneffekt leicht überschritten.
In Ihrem Buch weisen Sie auf die Schwierigkeiten hin, die die Winzer auf dem Schweizer Markt haben. Ist der Mangel an internationaler Anerkennung ein Grund dafür?
Das ist die alte Geschichte von der Henne und dem Ei. Die Weine aus Bordeaux bauten ihren Ruf ab dem 12. Jahrhundert auf, als die Herzogin von Aquitanien durch Heirat den Thron von England bestieg, was den Zugang zu den britischen und niederländischen Märkten ermöglichte. Die Weine aus Burgund gewannen im späten Mittelalter an Ansehen, als der Wein für die grossen Monarchen, die die reichsten Lehen in Westeuropa beherrschten, zu einem Attribut von Macht und Prestige wurde. Näher an unserer Zeit: Der italienische Weinbau war in den 1950er Jahren in einem fast «mittelalterlichen» Zustand und genoss im Ausland keine Anerkennung für Spitzenleistungen, da seine Produkte von bisweilen fragwürdiger Qualität zu sehr niedrigen Preisen exportiert wurden. Die Übernahme der Kontrolle durch ein Kollektiv (Behörden, Experten, Bauern usw.) und die Unterstützung durch die EU haben dazu geführt, dass italienische Weine innerhalb weniger Jahrzehnte zur Weltspitze aufgestiegen sind. Meiner Meinung nach besteht das grosse Paradoxon der Schweizer Weine derzeit darin, dass die Eröffnung einer neuen internationalen Front eine Schwächung unserer Position an der internen Front bedeuten würde. Die verfügbaren finanziellen Mittel können leider nicht erhöht werden. Um es mit anderen Worten auszudrücken, es heisst den Teufel durch Beelzebub austreiben. Das Beispiel Italiens könnte der Schweizer Weinbranche als Inspirationsquelle dienen.
Könnten sich Schweizer Weine international als Premiumprodukte profilieren?
Seit mehreren Jahren versuchen Schweizer Produzenten, sich im Premium-Segment zu profilieren. Auf individueller Ebene sind einige erfolgreich, aber wenn wir das Gesamtvolumen unserer Grand-Cru-Weine betrachten, ist der Durchbruch zu gering, um von einem Imageeffekt zu profitieren. Meiner Meinung nach muss man bereits über eine Export-Plattform verfügen, die im weltweiten Weinhandel fest verankert ist, um auf den ausländischen Märkten für Spitzenprodukte erfolgreich zu expandieren. Dies ist jedoch nicht der Fall und der Aufbau einer solchen erweist sich als ein äusserst waghalsiges und kostspieliges Unterfangen von unsicherem Ausgang, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Dies gilt umso mehr, als wir sowohl von allen Gliedern der internationalen Vertriebskette als auch vom Endverbraucher, ob Experte oder nicht, keinesfalls als ein «grosses Weinland» wie Frankreich oder Italien wahrgenommen werden. Sie gehören einer anderen Liga an und wir sollten nicht päpstlicher als der Papst sein. Die folgende Frage stellt sich: Ist «High-End» wirklich die richtige Strategie?
Ist der Multikulturalismus unseres Landes für unsere Weine ein Hindernis, im Ausland ein klares Image zu haben?
Eine nationale Identität des Schweizer Weins gibt es nicht. In unserem Land sind die treuen Kunden von Schweizer Weinen (1/3 der Bevölkerung) besonders an lokalen oder kantonalen Weinen interessiert. Um die Hälfte der Konsumenten, die nie einheimische Weine kaufen, zu überzeugen, muss man gezielt aktiv werden, innovativ sein und die Kraft auf zukunftsträchtige Bereiche bündeln. Dies wird nach und nach zu einer homogenen Identität führen. In der Folge wird es viel leichter sein, unseren Bekanntheitsgrad im Ausland zu erhöhen.
Wäre es für Schweizer Weine nicht einfacher, sich an französische Kunden zu wenden, die die gleiche Sprache sprechen?
In Frankreich beträgt der Anteil ausländischer Weine am nationalen Konsum nur 6 %. Es ist ein nahezu verschlossener Markt. Nur die Grossstädte zeigen sich etwas «liberaler», aber dort ist das ausländische Angebot bereits sehr präsent.
Könnte das Interesse der Schweizer Weinkellereien an Bio und Biodynamie das Image von Schweizer Weinen im Ausland stärken?
Dieser Weg bietet das Potenzial, das Image der Schweiz und ihrer Weine gleichermassen zu stärken. Das Image eines Landes spielt bei der Wahrnehmung der Qualität eines Produkts eine Rolle. Grosse Weinproduzenten (Frankreich, Italien usw.) profitieren von einem Halo-Effekt, einer Glaubwürdigkeit und Legitimität, die den Export ihrer Weine in die ganze Welt erleichtert. Beispielsweise wird Wein mit Frankreich in Verbindung gebracht (aristokratische Vergangenheit, Luxusindustrie usw.) und umgekehrt (grosse Châteaus, prestigeträchtige Weine usw.). Ein starkes Gespann für sich. Wenn ein Wein aus einem Land kommt, das nicht als Weinland wahrgenommen wird - was bei uns der Fall ist -, verwendet der ausländische Verbraucher sein Bild von diesem Land, um den Wein zu bewerten. Doch obwohl die Schweiz einen ausgezeichneten Ruf geniesst, kann sie aus diesem Ruf für ihre Weine nicht Gewinn schlagen, warum? Das Image des «gehobenen» oder «Premium»-Bereichs, das man zu vermitteln versucht, entspricht eher Frankreich. Die Schweiz ist eines der reichsten und auf politische und soziale Gleichheit ausgerichtesten Länder der Welt. Ihr Wohlstand wird nie demonstrativ zur Schau gestellt, im Gegenteil, sie weiss, wie man bescheiden und zuverlässig zugleich bleibt. Die ökologische Schiene scheint mir sehr relevant zu sein und dieser Ansatz passt perfekt zur Schweizer DNA.
Gibt es keinen Export, weil es kein Image gibt, oder gibt es kein Image, weil es keinen Export gibt?
Der Export stellt einen Beschleuniger in einem Prozess des Imageaufbaus dar, ist aber keinesfalls dessen Auslöser.
Könnte die Weinbranche vom Erfolg unseres Käses oder sogar unserer Uhren lernen?
Diese beiden Branchen bieten eine perfekte Übereinstimmung zwischen den Werten (Tradition, Authentizität usw.), die sie durch ihr Produkt und ihre Kommunikation repräsentieren, und den nationalen Werten. Sie überlagern sich und bilden einen sehr starken identitätsstiftenden «Block». Auf dem internationalen Markt muss man ein Kundennetz aufbauen. Dies dauert Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. Im 19. Jahrhundert mit dem Aufkommen der Eisenbahnen stellten die Bauern auf Milchprodukte um. Demzufolge begannen sie schon früh damit, Kondensmilch und Käse zu exportieren. Dasselbe gilt für die Uhrmacherei, die sich mit der Einwanderung der Hugenotten im 17. Jahrhundert in der Schweiz ansiedelte. Unser Land hat tatsächlich eine Exportstärke für seinen Käse und seine Uhren entwickelt, allerdings erst im Laufe von ein bis zwei Jahrhunderten. Die Schweizer Weinbautradition hinkt im Vergleich etwa zu Österreich um Jahrhunderte hinterher. Es war ein Imperium, sie beherrschten Europa und hatten ein Netzwerk. Dank dieser Vorgeschichte sind sie heute sehr stark. Das ist der Kern des Problems.
Ist diese Imagearbeit im Ausland vor allem Aufgabe der Institutionen oder der Winzer selbst?
Ein Image aufzubauen ist ein langer Prozess. Es händelt sich um eine umfassende Arbeit, deren Erfolg von allen Akteuren abhängt. Die gesamte Wertschöpfungskette - von der Förderung über den Weinbau, die Produktion, die Logistik, die Vermarktung, den Vertrieb usw. - muss integriert werden. Mehr als Schweizer Weine zu werben, muss man einige vielversprechende Nischen besetzen. Nachdem ich mich über zwei Jahre lang mit der Weinbranche befasst habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das Problem unseres Weinbaus eher auf unterschiedliche Interessen oder Zukunftsvisionen der Protagonisten der Branche zurückzuführen ist als auf die umgebende Konjunktur- und Strukturkrise.