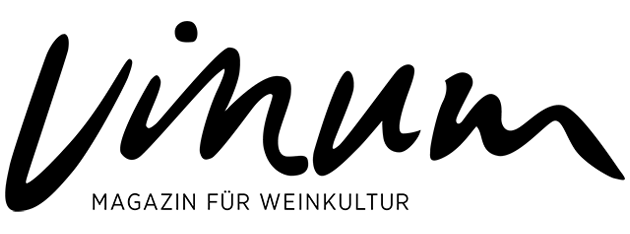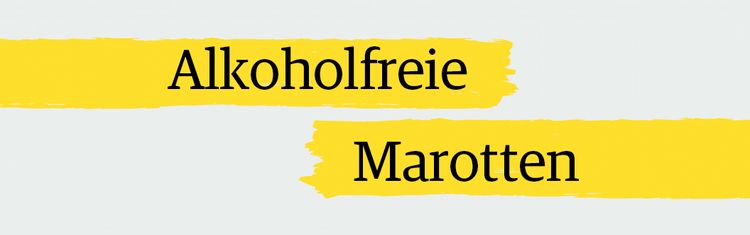Thomas Vaterlaus über die Zukunft des Weinkonsums
Wein, deine beste Zeit kommt!
Text: Thomas Vaterlaus

Die Zeiten, in denen Wein ganz selbstverständlich auf den Tisch kam, sind vorbei. Das einstige Alltagsgetränk mutiert immer mehr zum Elixier für besondere Gelegenheiten. Der zurückgehende Konsum führt zu Panik in der Branche. Dabei eröffnet die Entwicklung auch neue Chancen: «Reduce to the max!» heisst die Devise.
Es ist eine gemeine Frage. Meist kommt sie beiläufig. «Wie viel Wein trinkst du eigentlich so durchschnittlich pro Tag?» Das ist der Moment, um kurz innezuhalten und so zu tun, als ob man am Rechnen sei, um schliesslich ehrlich zu antworten: «Nun ja, schätzungsweise ungefähr eine halbe Flasche.» Nach so einem Geständnis stellt sich nicht selten eine etwas unangenehme Stille ein, gefolgt von Kommentaren wie: «Uuiii, dann bist du ja eigentlich ein Alkoholiker…» Natürlich gibt es Argumente dagegen, viele Argumente sogar, etwa die intakten Leberwerte oder die Tatsache, dass sich keinerlei Entzugserscheinungen einstellen, wenn es mal keinen Wein gibt. Taktisch besser ist aber der Einwand, dass es doch gar nicht so wichtig sei, wie viel Wein man trinke, sondern was für welchen. Dass ein handwerklich produzierter Terroirwein, beispielsweise ein Village-Gewächs aus Puligny-Montrachet, den Geniesser nach einem stressigen Tag direkt in die Weinberge des Burgund zu katapultieren vermöge, so dass er den Kalkstein riecht und sogar den Anflug von Rauch, der entsteht, wenn die Winzer im Winter ihr Rebholz verfeuern, sofern sie das überhaupt noch dürfen. Aber solche Geschichten nähren meist nur den Verdacht, man wolle mit blumigen Anekdoten ein Problem schönreden. Was nach solchen Diskussionen bleibt, ist die Frage: Sind wir Weinliebhaber aus der Generation der Babyboomer womöglich Angehörige einer langsam aussterbenden Spezies? Und sollten auch wir anfangen, das abendliche Glas Wein durch Yoga-Übungen zu ersetzen, auch dem Rücken zuliebe?
Das Genusselixier Wein steht im Gegenwind. Beginnend mit der Generation der Millennials und erst recht mit der Generation Z, die es inzwischen sogar geil findet, in alkoholfrei geführten Clubs abzutanzen, nimmt der Stellenwert des Rebensaftes ab. Anderes scheint wichtiger zu sein. Allfälligen Intoleranzen vorbeugen. Mit glasklarem Kopf am Weekend zu einer Bergtour starten. Oder ganz einfach mit 20 Jahren schon so leben, dass man theoretisch die Hundert vollmachen könnte. In der Vergangenheit hatten wir Weintrinker wenigstens teilweise noch den Segen der Wissenschaft. Studien, basierend auf Phänomenen wie der Mittelmeerdiät oder dem «French Paradox», deuteten darauf hin, dass ein moderater Weinkonsum vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt und sich positiv auf die Lebenserwartung auswirkt. Inzwischen wird auch das zunehmend in Frage gestellt und heftig darüber gestritten, ob ein Glas Rotwein nun die Gesundheit fördert oder gefährdet. Für die Präventiv-Aktivisten, die uns Weinliebhaber mit ihren Schock-Plakaten von unserer Sucht befreien wollen, ist der Fall eh längst klar: Jedes Glas sind zwei zu viel.
Genuss geht über die Qualität im Glas hinaus
So kommen wir zur entscheidenden Frage: Welche Rolle wird der Wein in Zukunft spielen? Ich bin da trotz der gegenwärtigen Tristesse sehr zuversichtlich! Der Wein hat seine beste Zeit noch vor sich. Aber nur, wenn wir es schaffen, den Rebensaft nicht mehr durch die Optik der Menge zu betrachten. Weil fast alle Statistiken in Litern geführt werden, wird manchmal vergessen, dass die Konsumenten zwar weniger trinken, dafür aber durchaus bereit sind, mehr Geld für eine Flasche Wein auszugeben. Logischerweise steigt aber beim höheren Preis auch die Erwartung an den Inhalt. Der Trend zum kontrolliert biologischen Weinbau ist erfreulich, aber es gibt immer noch sehr viel Luft nach oben. Wenn jemand 40 Franken für eine Flasche Wein zahlt, möchte er keinen Winzer im Schutzanzug sehen, der im Nebel der Fungizide steht, die er selbst gespritzt hat. Und er möchte auch nicht, dass der Wein aus einer Industrieanlage kommt, die einer Ölraffinerie nicht unähnlich ist. Weingenuss definiert sich je länger, je mehr in einem stark erweiterten, ganzheitlichen Kontext. Ein Wein kann noch so gut sein, doch wenn er im An- und Ausbau den Boden belastet und die Artenvielfalt bedroht, verliert er sein Genusspotenzial. Und Geniesser sind nicht dumm. Sie durchschauen oberflächliches Greenwashing. Was der Weinmarkt mehr denn je braucht, ist belegbare Nachhaltigkeit, mit dokumentierten Absenkungspfaden bezüglich Spritzmittel- und Energieverbrauch über Jahre hinweg. Gute Weine, die glaubhaft machen, dass sie nicht nur Vertreter ihres Terroirs, sondern auch eines intakten Ökosystems sind, haben eine grosse Zukunft vor sich. Und dürfen entsprechend mehr kosten.
Sprechen auch Sie Klartext!
Diskutieren Sie mit - zum Beispiel auf unseren Social Media Kanälen. Sie haben kein Facebook oder Instagram? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@vinum.ch.