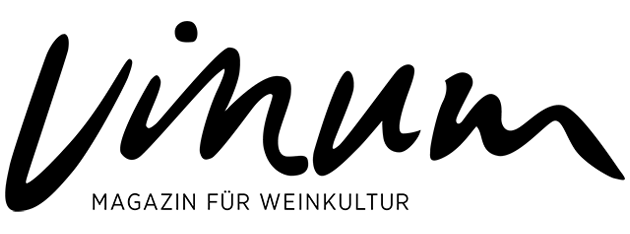Wein-Verschluss-System – eine echte Innovation?
02.02.2015 - R.KNOLL
DEUTSCHLAND (Würzburg) - Ein neues Weinsystem für glasweisen Ausschank macht scheinbar Karriere, ist in etlichen renommierten gastronomischen Betrieben zu finden und soll laut Presseinformation „eine Revolution in der Weinwelt“ darstellen. Coravin heißt es. Aber ist es wirklich eine Erfindung, über die man pauschal glücklich sein kann?
Systeme bei Schankanlagen und auch für Einzelflaschen, bei denen mit Stickstoff gearbeitet wird, um den Wein frisch zu halten, gibt es schon lang. Aber nach einigen Tagen machen sich in der Regel Beeinträchtigungen bemerkbar. Bei der Neuerung aus den USA wird mehr versprochen; gleich über Monate oder sogar noch etwas länger soll ein Wein aus einer „angezapften“ Flasche sich nicht verändern.
Zunächst einmal klingt alles eindrucksvoll. Im Unterschied zu anderen Systemen bleibt hier der Korken in der Flasche und der Korkenzieher in der Schublade. Stattdessen wird eine sehr dünne Hohlnadel durch Verschlussfolie und Korken geführt. Im nächsten Schritt wird das Edelgas Argon in die Flasche eingelassen. Der dabei entstehende Druck treibt den Wein in die Nadel und von da ins Glas, ohne dass er mit Sauerstoff in Berührung kommt. Nach dieser „Operation“ und „Transfusion“ wird die Nadel entfernt und der Korken verschließt sich von selbst wieder. Das Gas erfüllt die Funktion von Stickstoff, bleibt aber nach Darstellung des Herstellers lange Zeit präsent, so dass der Weinschwund keine Auswirkungen hat.
Wein-Prominenz wie Robert Parker und Jancis Robinson sind scheinbar begeistert von Coravin. So mancher Gastronom schwärmt ebenfalls davon und spricht von einer der großen Innovationen der Wein-Welt. Manche sehen zudem sicher den Show-Effekt und freuen sich über die Erstaunen der Gäste am Tisch. Es wird auch versichert, dass das System tadellos funktioniert und die Möglichkeit gibt, bedeutende Weine risikolos glasweise einzuschenken. Zuhause könne man damit ebenfalls aktiv werden. „Sind Gäste da, kann jeder den Wein trinken, den er bevorzugt, ohne dass am Ende des Abends etliche geöffnete Flaschen übrig bleiben und der Wein verdirbt“, heißt es in einer Presseinformation.
Aber das sind Behauptungen, die etwas zu pauschal anmuten. Nicht jeder Wein verdirbt sehr schnell. Nicht selten ist der Kontakt mit Luft und die damit verbundene zarte Oxidation sogar ein Gewinn. Es gibt Topwinzer, die ihre besten Weine gern aus Anbruchflaschen servieren, weil sie wissen, dass sie so sich vorteilhaft entwickeln. Süßweine bleiben ebenfalls Wochen oder Monate im Anbruch in Bestform. Der hohe Zuckergehalt macht es möglich, er konserviert. Unvergessen bleibt eine Silvaner Beerenauslese aus Franken vom Jahrgang 1967. Sie wurde 30 Jahre später entkorkt, ein kleiner Schluck genossen und dann wieder ganz normal mit Naturkorken verschlossen. Die Prozedur wiederholte sich im Jahresrhythmus. Nach über zehn Jahren schmeckte der letzte Rest fast genauso perfekt wie der Inhalt einer weiteren Flasche des gleichen Weines.
In guter Erinnerung ist ein teurer 1971er Bordeaux, der beim Öffnen Düfte verströmte, die sehr faulig anmuteten und schon überlegen ließen, ob es nicht besser sei, den Wein wegzukippen. Es war gut, dass er am nächsten Tag eine neue Chance bekam und plötzlich eine Offenbarung war. Die Gläser am Tag drauf und noch später ließen ebenfalls strahlen. Mit Coravin wäre das nicht passiert, da wäre die üble Nase wohl eingesperrt geblieben.
Freuen mag sich die Korkindustrie, dass es das System gibt. Freilich sind wir in Deutschland heute bei einem Anteil von mehr als 50 Prozent beim „Schrauber“ angelangt. Und längst sind es nicht mehr nur preiswerte Weine, die mit dieser Alternative verschlossen sind, sondern oft exzellente Tropfen. Sicher, Top-Rotweine haben in der Regel nach wie vor einen Korken im Flaschenhals. Aber bei den mittlerweile durchaus edel anmutenden Schraubverschlüssen (und bei Glas) ist Coravin hilflos.
Bleibt noch der Preis zu erwähnen. Ein komplettes System mit „OP-Gerät“, zwei Kapseln mit Argon und einem Neopren-Flaschenüberzug kostet immerhin 299 Euro. Pro Kapsel lassen sich nach Angaben des Herstellers etwa 15 Gläser a‘ 0,15 l entnehmen. Das entspricht dem Inhalt von drei Flaschen Wein. Wenn die zwei Kapseln aufgebraucht sind, ist Nachschub notwendig. Drei Argongas-Behälter kosten 29,95 Euro, wer sich einen größeren Vorrat mit 24 Kapseln zulegen will, muss 215 Euro ausgeben,
Lesen Sie auch unsere weiteren Beiträge zum Thema:
Zurück zur Übersicht