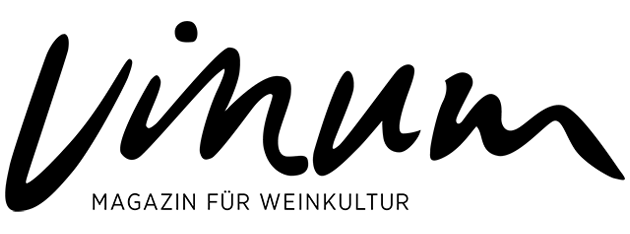Jubiläum in Franken: Vom Mainriesling zum Rieslaner
29.11.2013 - R.KNOLL
DEUTSCHLAND (Würzburg) - „Niederfall“ ist keine weinfränkische Disziplin, um kritische Journalisten zu bestrafen, sondern eine Art Erntedankfest. Die Versionen reichen vom Weglegen des Arbeitsgerätes bis zum Dankgebet auf den Knien für eine gut verlaufene Weinernte. Die Verbindung mit einem herz- und schmackhaften Essen lassen sich die Franken dabei nicht nehmen. Der „Niederfall“, zu dem Frankens VDP seit einigen Jahren einlädt, hat dazu stets ein Thema. Es war in diesem Jahr geeignet zu einem ehrfürchtigen Kniefall vor einer Sorte, die in Franken gezüchtet wurde und deren besondere Fähigkeiten scheinbar etwas in Vergessenheit geraten.
Die Rede ist vom Rieslaner, der 1921 von Dr. August Ziegler, dem damaligen Leiter der Würzburger Rebenzüchtung, aus Silvaner und Riesling gekreuzt wurde, dann trotz erster Komplimente für die Weine („…wundervoller, eleganter, edler Riesling“) aus dem Blickfeld der Winzer verschwand und erst nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Ziegler-Nachfolger Prof. Dr. Hans Breider wieder in den Fokus gerückt wurde. 1953 wurde die Sorte, vier Jahre vor dem nationalen Sortenschutz, in Franken als Mainriesling anerkannt. Aber sofort wurde gegen diesen Namen wegen der Verwechslungsgefahr mit dem Rheinriesling außerhalb Frankens votiert.
Ein neuer Name musste gefunden werden. Nach einem längeren vergeblichen Kampf für den Mainriesling trafen sich Vertreter der Betriebe Bürgerspital, Staatlicher Hofkeller, Domäne Castell und Paul Schmitt im Frühjahr 1963 und einigten sich auf Rieslaner. Weil die Sorte die Neigung zur Botrytisbildung hatte, wurde sie vor allem für die Gewinnung von edelsüßen Weinen geschätzt. Dabei zeigt sie durchaus Riesling-Eigenschaften, nämlich Rasse und anregendes Säurespiel. Im Aroma gibt es Unterschiede, hier ist eine exotische Fruchtausprägung mit Düften nach Mango, Banane und Maracuja typisch.
Doch die Sorte hatte auch, bevor sie züchterisch mittels Klonen-Selektion weiter bearbeitet wurde, ihre Macken. Weil sie hohe Reife benötigt, ist sie wenig geeignet für den Ausbau trockener Weine. Denn diese können leicht zu alkohollastig ausfallen. Ein anderes Problem war früher die Blüteempfindlichkeit. Sie führte zu extrem geringen Erträgen, in manchen Jahren weniger als 10 Hektoliter auf dem Hektar. In den achtziger Jahren änderte sich das allmählich, so dass der Rieslaner vor allem für qualitätsbewusste Erzeuger wieder interessant wurde und im Prädikatsbereich bei Versteigerungen hohe Preise erzielte.
Ein bekannter Promotor des Rieslaner wurde der Pfälzer Hans-Günter Schwarz in seiner Ära als Betriebsleiter des Weingutes Müller-Catoir in Neustadt-Haardt. Er bezeichnete die Rebe zwar als „äußerst sensibel“, entlockte ihr aber durch geringe Erträge bei hoher Reife geniale fruchtige Weine. Auch Klaus Keller aus Flörsheim-Dalsheim war schon bevor sein Betrieb überregional bekannt wurde ein Verfechter des Rieslaner. 1970 warb er um seine spätere Gattin Hedwig mit einer Rieslaner-Auslese, 21 Jahre später schenkte er ihr zu Weihnachten sogar einen Rieslaner-Weinberg.
Schwarz und Keller waren auch mit Weinen bei einer denkwürdigen Verkostung im Vorfeld des „Niederfall“ vertreten. Schwarz betreut inzwischen das Weingut Minges in Flemlingen auf dem Sektor Aromasorten; die 2012er Spätlese von Minges schmeckte wie der Biss in einen saftigen Apfel. Die 2012 Monsheimer Auslese, vinifiziert von Junior Klaus-Peter Keller, tanzte beschwingt Ballett auf der Zunge. Aber noch mehr beeindruckten reife Versionen, vor allem ein einmal neu verkorkter, vielschichtiger 1953er Mainriesling vom Weingut Robert Schmitt und ein zeitloser, rassiger 1963er von der Castell’schen Domäne.
Dass der Rieslaner auch als Eiswein glänzen kann, demonstrierten die Güter Ruck aus Iphofen (1998) und der Staatliche Hofkeller Würzburg (1999) mit brillanten, geschliffenen Weinen aus gefrorenen Trauben. Ebenfalls sehr jugendlich: die cremige 1988er Beerenauslese vom Zehnthof Luckert aus Sulzfeld und die enorm konzentrierte 1992er Beerenauslese von Schmitt’s Kinder, die mit ihren 160 Grad Oechsle eigentlich eine Trockenbeere war.
Bleibt die Frage nach dem Stellenwert des Rieslaner:
Die Fläche ist nicht nur in Franken abnehmend. 35 Hektar sind es aktuell noch in bayerischen Fluren; ähnlich ist die Größenordnung in der Pfalz; bundesweit sind es kaum mehr als 80 Hektar. Fränkische Winzer stellen die Frage, ob die Journalisten zu wenig über Rieslaner schreiben. Umgekehrt wird ebenfalls ein Schuh daraus. Die Erzeuger sind mit dieser Sorte nicht sonderlich offensiv unterwegs. Auch im aktuellen Gault Millau ist kaum Rieslaner zu finden.
Zurück zur Übersicht