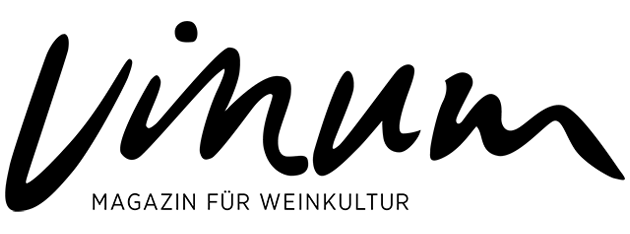Bordthäusers Sensorikschule
Mit allen Sinnen
Folge 5: die Nase
«Den kann ich nicht riechen!» – was für Menschen gilt, trifft auch auf Weine zu: Das Riechen ist eine hochemotionale Angelegenheit. Und das kann uns beim Weinverkosten schon mal ins Stolpern bringen.

Alles, was duftet, sendet Moleküle in die Luft aus. Diese nehmen wir wahr, solange wir atmen. Aber wie funktioniert das? Lange Zeit wusste man nur, dass das Riechen in einem Stück Nasenschleimhaut von etwa fünf Quadratzentimetern Grösse stattfindet, und man nahm an, dass Duftreize ebenso wie visuelle Reize über bestimmte Proteine an einen Rezeptor gekoppelt werden. Auf den besagten fünf Quadratzentimetern Nasenschleimhaut befinden sich circa zehn Millionen Nervenzellen, an deren Enden, den Cilien, Rezeptorbündel in die Nasenhöhle hängen. An denen docken die Düfte an. Man kann es sich vorstellen wie Fliegen, die an einem Fliegenfänger kleben bleiben. Von dort gelangt die Duftinformation in die Hirnrinde und weiter ins limbische System. In den Rezeptorzellen wird der Duftreiz elektrisch übersetzt – elektrische Impulse sind ja sozusagen die Sprache des Gehirns.

So weit, so gut. Dann traten die beiden US-amerikanischen Medizinforscher Linda Buck und Richard Axel auf den Plan, die 2004 mit dem Nobelpreis für Physiologie/Medizin ausgezeichnet wurden. Warum? Sie hatten herausgefunden, dass das Gehirn auf unzählige Kombinationen zurückgreift, um die Vielzahl an Duftreizen zu unterscheiden, und dass dabei die Genetik eine riesige Rolle spielt. Ihr Forschungserfolg bestand darin, das Pferd von hinten aufzuzäumen: Sie suchten nicht nach den zu einem bestimmten Duftreiz passenden Rezeptoren, sondern nach den dafür verantwortlichen Genen. So setzten sie ein isoliertes Gen in eine Zelle, die darauf den Maiglöckchenduft erkannte. Diese Entdeckung war bahnbrechend, denn das Ergebnis dieser Forschung war, dass der Mensch über 339 funktionsfähige Rezeptorgene verfügt, die allein für das Riechen zuständig sind. Das sind gut drei Prozent des gesamten menschlichen Genoms, und damit ist es die grösste Genfamilie überhaupt! Keine andere Einzelfunktion des Körpers beansprucht einen so grossen Teil unserer Genetik wie das Riechen.
Gegenbeispiel: Für die Wahrnehmung von Farben stehen uns drei Rezeptorgene zur Verfügung (für alle Spektren!). Der Mensch antwortet also auf die Menge an Düften in der Natur mit verschiedenen Rezeptoren, die durch die dafür verantwortlichen Gene gebildet werden. Das heisst, für jedes Duftmuster gibt es ein entsprechendes Molekül, das für dessen Rezeption verantwortlich ist. Am besten stellen wir es uns vor wie einen Schlüssel mit einem spezifischen Bart, der ins richtige Schloss passt. Für jeden der Zehntausende von Duftreizen einen eigenen Rezeptor bereitzuhalten, ist allerdings auch für die Nase zu viel, sie setzt daher auf Kombinationen. Ein Reiz kann also durchaus mehrere Rezeptoren ansprechen, die ihn dann in unterschiedlicher Intensität wahrnehmen.

Die Zellen mit den verschiedenen Rezeptoren liegen wahllos nebeneinander auf der Nasenschleimhaut, und erst im sogenannten Riechkolben, dem Bulbusolfactorius, werden die gesammelten Informationen dann sortiert. Riechen ist aber nicht nur eine molekulare, sondern auch eine sehr emotionale Angelegenheit. In der Amygdala, einem Teil des limbischen Systems im Gehirn, werden Sinneseindrücke mit Emotionen, Erinnerungen, Assoziationen und Motivationen verknüpft. Hier entscheidet sich, welches Gefühl ein bestimmter Duft in uns hervorruft, vom Angstschweiss bis zum Moselriesling. Und während alle anderen sensorischen Reize in irgendeiner Art erst «übersetzt» beziehungsweise im Thalamus, einem Bereich im Zwischenhirn, verschaltet werden müssen, bildet der Geruchssinn die einzigartige Ausnahme: Er geht als einziger Sinnesreiz direkt in die Grosshirnrinde, genauer gesagt in den olfaktorischen Cortex, und weiter in die Amygdala.
Der Weg von der Wahrnehmung eines Geruchs zur emotionalen Reaktion ist damit extrem kurz.Was zeigt, dass es sich hier um Reize von enormer Wichtigkeit handelt, bei deren Entschlüsselung keine Übersetzungsfehler geduldet werden können. Die Verbindung von Emotionen mit den Duftreizen ist das wichtigste Alleinstellungsmerkmal überhaupt. Und hier liegt der Hase im Pfeffer: Ist ein Duft einmal negativ (oder positiv) bewertet, ist dies gespeichert. Diese individuelle emotionale Belegung der Duftreize führt folglich zu Unschärfen bei der Bewertung von Düften. Sie ist stets subjektiv und kann hinderlich sein bei unserem Ziel, die Qualitäten eines Weins in einer einheitlichen Sprache zu bewerten.
Wer vor 20 Jahren einen grantig-sauren Moselriesling getrunken hat, dem mag der Riesling vielleicht zu Recht vergällt sein, aber: Wir haben die Gabe zum Umlernen. Das beste Beispiel wäre hier der Lernerfolg, einen bitteren Geschmack als positiv zu empfinden (nachzulesen in Folge 4 unserer Sensorikschule). Brühen wir uns also eine schöne Tasse Kaffee bis zur nächsten Ausgabe: Dort werden wir die Duftreize im Detail unter die Lupe nehmen.