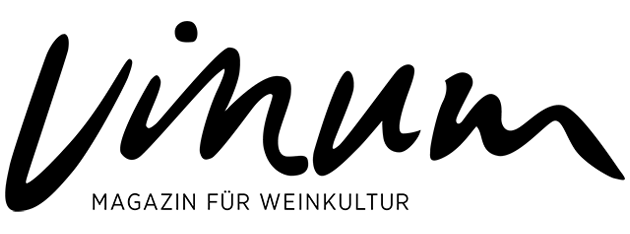Mit Handwerk gegen Krankheiten
Retten, was noch zu retten ist
Text und Fotos: Rolf Bichsel

99 Prozent der heute gepflanzten Reben werden nicht länger als 20 bis 30 Jahre leben. Der berühmte Satz «Erst alte Reben ergeben guten Wein» verkommt zur leeren Worthülse. Doch das scheint kaum jemand zu stören. Wer die heutigen Praktiken der Rebenveredelung in Frage stellt, gilt als blauäugig und naiv. Dabei gibt es eine einfache Lösung: das Pfropfen im Rebberg.

Beginnen wir mit einem Geständnis. Seit über 30 Jahren beschäftige ich mich intensiv und täglich mit Wein. Ich habe verkosten gelernt, spucke mit schlechtem Gewissen jährlich Tausende von guten Weinen in den Napf, weiss im Schlaf, wie Wein gekeltert wird, kann ein grosses Terroir von einem kleinen unterscheiden und einen ordentlichen Rebschnitt von einem unordentlichen. Seit über 30 Jahren nehme ich als Selbstverständlichkeit hin, dass in unseren Rebgärten europäische Edelreiser wachsen, die auf Unterlagsreben amerikanischen Ursprungs gepfropft worden sind, damit die Reblaus nichts zu lachen hat. Die einzige Frage, die ich mir nie gestellt habe während all der mit Wein vertrödelten Zeit: Woher zum Geier kommen die Setzlinge eigentlich? Wer sorgt dafür, dass die Begegnung zwischen Zweig und Wurzel klappt und aus der glücklichen Ehe Traubenkinder spriessen? Die Frage ist ja auch zu dämlich, denn die Antwort kennt jeder: die Rebschule natürlich. 99 Prozent aller in der Welt gepflanzten Reben stammen aus mittelgrossen bis grossen, auf das Pfropfen von garantiert gesunden Klonen spezialisierten, streng kontrollierten Fachbetrieben. Garantiert gesund? Auch zu dieser Frage hätte ich mit dem Brustton der Selbstüberzeugung ja gemurmelt, hätte nicht auch ich eine Begegnung gemacht. Eine Begegnung, die meine Art, den Wein (und damit den Weinbau) zu sehen, völlig über den Haufen geworfen hat.
Auf Marc Birebent bin ich durch einen dieser Zufälle gestossen, die das Salz des Lebens ausmachen. Eines Tages sass er mir einfach gegenüber: schrammige Hände, vom Wetter gegerbtes Gesicht, zurückhaltend, bescheiden, stellte sich schüchtern vor als Sohn eines korsischen Winzers und anerkannten Fachmanns für Rebbau und als Leiter einer auf das Pfropfen von Reben spezialisierten Bude im Süden Frankreichs, die sein Vater gegründet hatte, war voller Bewunderung für meinen Job, was mein geplagtes Ego mindestens zwei Zentimeter anwachsen liess. Ein Rebschulvorsteher, sagte ich mir (Ignoranz kennt keine Grenzen) und fragte aus purer Höflichkeit (und weil Small Talk nun einmal dazugehört) nach Einzelheiten.
Natürlich hörte ich nur mit einem halben Ohr hin, denn wen interessiert schon, was als Selbstverständlichkeit gilt, verstand ohnehin nur jedes dritte Wort des mit leiser Stimme vorgetragenen Diskurses, der bei den alten Griechen und Römern begann und bei den Rebenspezialisten des 19. Jahrhunderts endete. Er sprach von Dionysos und Insitor, von Nahtstellen und Wülsten, von Transplantieren und Überpfropfen, von Veredeln mittels Messer, Zange, Auge, Zunge, Nase, Mund, von T-bud und Chip-bud, von englischer Kopulation und Gegenzunge, und alles kam mir nicht nur ziemlich spanisch, sondern auch ganz schön pornografisch vor. Ich war eben dabei, in Trance abzugleiten, wie der schlechte Schüler, den das Mädchen auf der Nebenbank ohnehin mehr interessiert als der theoretische Brei des griesgrämigen Lehrers vorne an der Wandtafel, als mich ein Satz wie der Wecker am Montagmorgen aus dem Halbschlaf schreckte: «Das zunehmende Dahinsiechen und das damit verbundene Verschwinden alter Reben ist keine Fatalität.» Im Nu war ich hellwach und protestierte.
Dahinsiechen? Verschwinden alter Reben? Jeder Winzer, dem ich begegne, spricht stolz vom hohen Durchschnittsalter der Reben, die oft der Gross- oder Urgrossvater gepflanzt habe und die anerkannt die besten Weine ergäben, tief verwurzelt im Boden, wo sie Nahrung und Wasser selbst in trockenen Sommermonaten fänden! Noch nie in der Geschichte des Weinbaus sind Rebberge so gut gepflegt worden, mehr und mehr auf natürlichere Art, fehlten so wenig Stöcke, grünten die Reben so grün! Mein Gegenüber schwieg und lächelte betreten. Doch der traurige Blick sprach Bände. Typisch Schreiberling, der naiv und gutgläubig nichts hinterfragt, was man ihm anträgt, und Kommunikation mit Information verwechselt, übersetzte ich betroffen.

Millionenverlust wegen Holzkrankheiten
Das Schweigen dauerte eine ganze Weile. Dann kam die Antwort, zögernd, mit Bedauern fast lautlos vorgetragen, als wäre er längst daran gewöhnt, dass niemand hören will, was er zu sagen hat: «Nein, unsere Reben sind nicht gesund. Ganz im Gegenteil. Hier die offiziellen Zahlen: 73 Prozent der Reben der französischen Anbaufläche sind von Holzkrankheiten befallen. Die bekannteste und gefürchtetste davon ist die Esca. 12 bis 15 Prozent unserer Reben produzieren gar keine Trauben mehr. Der Verlust aufgrund dieser Anfälligkeit wird auf rund sechs Millionen Euro jährlich geschätzt. So weit die offiziellen Zahlen. In den umliegenden Ländern ist es nicht viel anders. Gegen die Esca wird staatlich verordnet mittels Spritzungen von systemischen oder biologischen Mitteln vorgegangen. Dabei gäbe es viel einfachere und dauerhafte Lösungen. Es genügte, dem Problem auf den Grund zu gehen und das Übel an der Wurzel zu bekämpfen statt dessen Symptome. Doch offenbar redet man lieber Tatsachen schön, statt sich den echten Problemen zu stellen.»
Der sanfte Hieb schmerzte wie ein Peitschenschlag. Ich fühlte mich wie der Boxer, der nach dem unerwarteten K.-o.-Schlag aus dem Nebel auftaucht, wie der verliebte Pennäler nach dem verpatzten Rendezvous. Verliess den Ort der Begegnung mit dem dumpfen Gefühl der verlorenen Unschuld, mit dem Eindruck, das Leben würde nie mehr so sein wie früher.
Ich wollte mehr wissen, googelte mir ein paar Wochen die Finger wund, las mich quer durch die einschlägige Literatur, fragte Winzer aus, liess mir die offiziellen Zahlen bestätigen. Die Birebent’schen Argumente schienen unwiderlegbar. Am meisten erstaunte mich, wie wenig selbst erfahrene Winzer sich um die Sache scherten. Wie wenig mehr als ich sie über das Pfropfen und Veredeln wussten. Wie gottgegeben sie die teuflische Tatsache nahmen, dass unsere Rebberge offenbar seit mehreren Jahrzehnten mit Industriereben aus der Pflanzenfabrik bestockt werden. Was ich ferner entdeckte: Holzkrankheiten hat es immer schon gegeben. In gewisser Hinsicht sind sie sogar nützlich. Pilze und andere Mikroorganismen, sichtbare oder unsichtbare, aber auch Insekten oder Würmer verwandeln abgestorbene Materie in Humus. Wie alle Pilze haben die Holzfresser, die zum Ausbrechen der Esca führen, grundsätzlich kein Interesse daran, lebende Materie zu befallen. Wenn der Gastgeber stirbt, stirbt der Gast früher oder später ebenfalls. Warum entwickelt sich heute ein Symptom, das es immer schon gegeben hat, auf so rasante Art in der ganzen Welt? Warum leben heute gepflanzte Reben nicht länger als 20, 30 Jahre?

Ich verabredete mich erneut mit Marc Birebent, diesmal ganz offiziell. Der, sichtlich erstaunt darüber, dass sich jemand für seine Argumente interessierte, damit nicht lange hinter dem Busch hielt. «Einen Grossteil der Problematik kennst du schon. 99 Prozent aller heute gepflanzten Reben sind sogenannte Greffées-soudées (verschweisst-veredelt) aus Rebschulen, mechanisch in der Werkstatt gepfropft durch billige und wenig qualifizierte Angestellte. Bei dieser Art von Pfropfung wird das Gewebe der Pflanze verletzt und vernarbt schlecht. Es entwickelt sich ein Wulst aus abgestorbenem Holz. Davon ernähren sich die Pilze. Vom Dahinsiechen der Rebe sind praktisch nur werkstattgepfropfte Pflanzen und Klonselektionen betroffen. Alle Probleme lassen sich vermeiden, wenn man sorgfältig von Hand pfropft – was allerdings viermal länger dauert als mit der Maschine und darum als unrentabel gilt – und Reiser aus massaler Selektion verwendet.»
Eine uralte Methodik wiederentdeckt
Mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Bei der Akkordveredelung in der Rebschule, der Optimierung der Arbeitsleistung und des Ertrags verpflichtet (Rebschulchefs tun einfach exakt das, was die Kunden von ihnen erwarten, die auch mal bereit sind, ihre Setzlinge online im Ausland einzukaufen, um ein paar Cents zu sparen), wird die Wurzelrebe buchstäblich geköpft, der Durchmesser des Klons, mit dem man diese verschweisst, ist überhaupt nicht auf den Durchmesser der Trägerrebe abgestimmt. Resultat: Von Anfang an entwickelt sich ein Wulst von abgestorbenem Gewebe, der mit zunehmendem Alter der Rebe wächst – ein gefundenes Fressen für Schädlinge. Kaum ist die Scheinehe aus Klon und Unterlage gepflanzt, beginnt die Rebe zu spriessen. Der Edelpart absorbiert die ganze Kraft des ungleichen Paars. Damit die bei der Pflanzung ohnehin kläglich magere Wurzel (siehe Bilder) mithält, wird oberflächengedüngt: Sie wächst waagrecht statt senkrecht. Der Winzer hegt und pflegt die Pflanze, als handle es sich um eines seiner Kinder, begleitet sie präventiv mit reichlichen Dosen aller möglichen Spritzmittel, ob systemischer oder biologischer, besucht Kurse, um einen möglichst sanften Rebschnitt zu lernen (aktuell der letzte Schrei), und weiss bald mit der Rebschere umzugehen wie der Chirurg mit dem Skalpell. Doch nach zwei, drei Jahrzehnten geht der Stock dennoch ein.
Der Schuldige ist rasch gefunden: die böse Krankheit Esca, die einfach nicht begreifen will, welche Investition ein Rebberg darstellt, und dafür staatlich unter Acht und Bann gestellt wird. Biodynamik-Anhänger, die sich weigern, präventiv Präparate auszubringen, kommen vor Gericht, und solche, die sich dem nicht aussetzen wollen, duschen ihre Reben, kurz bevor es regnet, mit den verordneten (Bio-)Präparaten, damit diese so rasch wie möglich in Grund und Böden gespült werden. Dass es auch anders geht, beweisen Marc Birebent und seine Equipe seit über 30 Jahren. «Ich bestehe darauf, festzuhalten, dass es sich bei der Methodik, die wir anwenden, nicht um unsere Erfindung handelt», präzisiert er. «Es gibt reichlich Fachliteratur aus der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die uns inspiriert hat. Nach der Reblauskrise wurden alle Reben von Hand und im Rebberg veredelt. Erst etwa ab den 1930er Jahren löste die mechanische Kopulation (so heisst das tatsächlich) in der Werkstatt die alte Praktik ab, obschon namhafte Forscher vor den Konsequenzen warnten. Die uralte Technik der Handveredelung geriet in der Alten Welt in Vergessenheit und wurde nur noch in der Neuen Welt angewendet. Dort hat sie mein Vater Anfang der 1980er Jahre entdeckt, in Kalifornien, ausgeführt von mexikanischen Rebarbeitern. Wir haben sie einfach weiterentwickelt und heutigen Gegebenheiten angepasst.»
Hier vereinfacht dargestellt das Vorgehen: Zuerst wird die (ungepfropfte) Trägerrebe gepflanzt. Man lässt ihr nur einen «Tire-sève» («Saftzieher»), der kurz gehalten wird (zwei bis drei Augen) und so das Überleben der Pflanze garantiert. Indem man die Entwicklung des Luftteils der Pflanze einschränkt, favorisiert man die Entwicklung der Wurzeln. Auf der Suche nach der Grunddüngung entwickeln sich diese in die Tiefe. (Viele Hobbygärtner kennen dieses Prinzip.) Erst nach drei, vier, fünf Jahren (je später, desto besser) wird das Edelreis aufgepfropft, auf eine Pflanze, die bereits gut verwurzelt ist. Dabei wird die Trägerrebe nicht einfach geköpft: Ein leichter seitlicher Einschnitt, der das Gewebe nicht verletzt, genügt. Ein Auge (eine Knospe) der Edelrebe von etwa gleicher Grösse wie der Einschnitt wird eingefügt. Idealerweise wird es aus dem Holz alter massaler Stöcke gewonnen, die man vorher im Rebberg als qualitativ einwandfrei identifiziert hat, und nach dem Rebschnitt im Kühlhaus lagert, um es in der idealen Saison (Mai bis Juni in Europa) verwenden zu können. Resultat: weder eine klaffende Wunde noch abgestorbenes Holz, keine Probleme mit holzfressenden Monsterpilzen, kein oder kaum Absterben der Reben, nein, eine gesunde, resistente Pflanze, die jahrzehntelang leben wird. Die Technik ist (fast) so alt wie die Menschheit und so einfach, dass sie mit etwas Geduld und viel Praxis jeder lernen kann. Einziges Problem: Kaum einer weiss mehr, wie man kunstgerecht veredelt. Die Equipen, die mit Marc Birebent arbeiten, werden aus Südamerika eingeflogen. In Frankreich (und wohl auch im übrigen Europa) wird das Pfropfen, eine Technik, die noch vor 30, 40 Jahren jeder Bauer, jeder Gärtner beherrschte, nicht mehr unterrichtet.
Die ganze Problematik wird durch eine weitere Tatsache verstärkt: die Übermacht der Klone. Gewiss, zur Klonselektion kam es aus durchaus verständlichen Gründen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Wein Mangelware. Man war auf produktive Reben angewiesen und selektierte solche im Rebberg, die man im grossen Mass vermehrte. Ab den 1960er Jahren interessierte man sich wieder mehr für Qualität. Doch für ihre Widerstandskraft interessierte man sich nur bedingt. (Als Illustration mag die Tatsache dienen, dass heute verwendete zertifizierte Klone, etwa von Syrah oder Rolle, ganz besonders für Esca anfällig sind.) Doch wenn ein Klon ein krankheitsanfälliges Gen trägt und die Krankheit ausbricht, sind im uniklonalen Rebberg alle Pflanzen betroffen. Ist derselbe Rebberg massal bepflanzt, hat die Mehrheit der Pflanzen eine Chance, mit einem blauen Auge (oder besser, einer reifen Traube) davonzukommen.
Aus der Not (-Lösung) eine Tugend machen

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Weil alte Reben nach und nach aussterben, kommt es mehr und mehr zu einer drastischen Verarmung des Erbgutes, der Varietäten und damit der genetischen Vielfalt. Während 2000 Jahren legte man einen Rebberg für Hunderte von Jahren an. Die nach der Reblauskrise gepflanzten Stöcke überlebten ein knappes Jahrhundert. Heutige Reben sind nach 20, 30 Jahren out. Doch die Reben, die vor 30 Jahren von Marcs Vater im Feld veredelt wurden, zum Beispiel auf Mouton in Pauillac, sind gesund und leben fröhlich weiter. Denn ganz offensichtlich machen ausschliesslich Klone von mechanisch gepfropften Reben Probleme. (Laut einer Untersuchung hat die Technik der Pfropfung keinen bestimmenden Einfluss auf die Anfälligkeit der Pflanzen und sie sind alle gleich betroffen, doch in den Test einbezogen wurde ausschliesslich mechanische Veredelung *).

Durch Überpfropfen von Wurzeln mit massalen Reisern ist es sogar möglich, von Esca betroffene Rebberge zu retten, auch wenn Marc Birebent dies nur als Notlösung ansieht. Er will nicht Doktor spielen, sondern erreichen, dass wieder auf Dauer ausgerichtete Rebgärten angelegt werden, die keinen Notfallarzt nötig haben. «Im Idealfall werden Unternehmen wie unseres unnötig. Die Winzer sollten ganz einfach wieder selber veredeln lernen, damit sie unabhängig werden von industriell hergestellten Wegwerfpflanzen.»
Die blauäugige Vision eines realitätsfremden Idealisten? Zitieren wir einfach Gustave Foex, gar nicht weltfremder Professor an der landwirtschaftlichen Schule von Montpellier, der bereits 1895 schrieb: «Wir Winzer, Kleinbesitzer, veredeln wir unsere Reben selber, mit unseren eigenen Hölzern, mit unseren eigenen Trägern. Wenn wir unseren Kindern dauerhafte Rebberge hinterlassen wollen, müssen wir selber veredeln. Das ist so einfach, logisch, befriedigend und sogar rentabel. Die Zukunft des Weinbaus hängt davon ab.»
* Siehe: www.vignevin.com