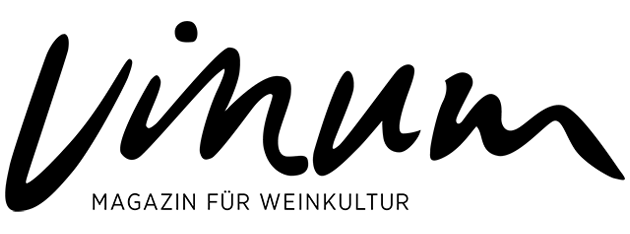Roussillon
Das verlorene Paradies
Text und Fotos: Rolf Bichsel, Recherchen: Barbara Schroeder
Hier steht ausnahmsweise keine Geschichte zum Träumen. Es ist vom Sündenfall die Rede, von gefallenen Engeln und Zwist. Da streitet Adam mit Eva, spielt Satan Versucher, zürnt Gott auf einem Pyrenäengipfel namens Canigou und straft Verrat mit brennender Sonne, klirrender Kälte, wütendem Wind, mit Kargheit und Unverständnis. Roussillon ist das verlorene Paradies.
Hauptakteur dieser schwarzen Messe ist eine Region in Südfrankreich, die irgendein Oberpfarrer oder Unterbischof im Namen der Verwaltungsdreifaltigkeit auf den Namen Languedoc-Roussillon getauft hat. Merke: Roussillon kommt hinten, ist nicht Wort am Anfang, sondern am Ende. Weinmässig feiert das Languedoc erfolgreich den Einzug in den Himmel – im Roussillon dagegen ist der Teufel los. Immerhin sorgt ein (aufoktroyierter?) Bindestrich für Zusammenhalt. Der müsste eigentlich auch in Sachen Wein greifen und den Riesen Languedoc und die Zwergin Roussillon so unzertrennlich machen wie Adam und Eva. Doch der Strich gefällt der Göre nicht, sie rebelliert, schert aus, schwört ab, stellt sich der Verbannung der Konsumentenpäpste, schmort im Fegefeuer der Wein-Inquisition, absolviert den Spiessrutenlauf des Imagemankos.
Echte Gründe für das Schisma sind rar. Ein paar Berggipfel höchstens, tiefer als Schweizer Voralpen. In Wirklichkeit weiss kaum einer, wo das Roussillon beginnt und das Languedoc endet, es gibt Ketzer und Renegaten. Vor allem aber ein uneinig Volk von Brüdern. Im Languedoc ist man Mischsatz und führt Gene all der Völker spazieren, die hier Haushalt hielten: Kelten, Griechen, Römer, Sarazenen, Westgoten, Juden, Iberer und andere mehr. Im Roussillon dagegen ist man sortenrein und Katalane, Frucht einer wilden Ehe zwischen einer sündigen Berglerin und einem Mittelmeerpiraten, nicht ganz Spanier, aber auch nicht so richtig Franzose, man fühlt sich verraten, vertrieben, verloren, verkauft, aus dem Paradies geekelt, an den hintersten Zipfel der Erde verbannt – und will das doch nicht anders, ist stolz wie ein Sarde, dickköpfig wie ein Korse und streitlustig wie ein Sizilianer im Mai, regiert lieber allein über die Hölle, als mit andern im Himmel zu dienen, und ist dabei auch noch schrecklich sympathisch. Bloss: Im Küstenort Banyuls gehen jedes Jahr ein paar Dutzend Hektar Rebland für immer verloren. Wenn es so weitergeht, wird die Küste hier bald wie ein Spiegelbild der Cinque Terre auf der anderen Seite des Mittelmeers gleichen, wo die uralten Rebterrassen unter der wuchernden Vegetation verwildern.
Zwischen Berg und Meer
In John Miltons 1667 publiziertem zwölfstrophigem Sinngedicht «Das verlorene Paradies» organisiert Luzifer – der schönste, charismatischste und rebellischste aller Engel – eine Palastrevolution. Er unterliegt, wird aus dem Himmel geschmissen, nimmt den Namen Satan an und gründet grollend die Hölle. Gott kontert und knetet Adam, dem er seinen Odem einhaucht; der beklagt seine Einsamkeit, spendet eine Rippe, aus der Eva wird, die sich prompt auf Satan einlässt, den verbotenen Apfel pflückt und aus dem Paradies verwiesen wird, gemeinsam mit Adam, der nicht auf Eva verzichten will. So richtig bedauern die beiden das vorerst nicht, ihnen gefällt die weite Welt, da gibt es Sex, Meer und Spass und keinen, der einem dauernd ins Zeug redet und Demut abverlangt.
«Besser über die Hölle regieren als im Himmel dienen.»
Satan in John Miltons «Paradise Lost» (1667)
Adam und Eva schienen nicht gewusst zu haben, dass zur Welt auch eine Ecke namens Roussillon gehört. Die liegt ganz hinten, da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, eingeklemmt zwischen kantigen Bergen und dem windigen Mittelmeer. Da sind urbare Böden rar und immer steil und steinig. Hier bläst der Wind jedes Körnchen staubtrockener Erde weg. Was bleibt, wird von den seltenen, aber heftigen Gewittern ausgewaschen, ausser man schichtet den kostbaren Boden in mühsamer Schwerarbeit zu Terrassen auf und schützt diese durch Trockenmauern.
Hier wächst meist nichts weiter als Olivenbäume, Reben und Unkraut, dieses aber, vom meerfeuchten Wind genährt, gleich meterhoch. DasU nkraut lässt sich in den steilsten Lagen nur mit der Spitzhacke bekämpfen oder per Maultiergespann. Kein Traktor schafft es den Weg über die schmalen Terrassen hoch. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass hiesige Winzer bis heute den Unkrautvertilger «Round up» als Geschenk des Himmels feiern, trotz seiner höllischen Giftigkeit. Doch selbst wenn alle Anstrengungen fruchten und die Rebe endlich Trauben trägt, sind die Erträge so niedrig wie nirgendwo sonst auf der Welt, und sie sinken immer weiter – wo Gott schmollt, straft Petrus mit Klimaerwärmung und fehlendem Regen.
Genossenschaften sind gut
Vom Rebbau allein kann im Roussillon auf Dauer kaum einer leben. Vielen bleibt nichts anderes übrig, als sich einer Genossenschaft anzuschliessen und neben dem Winzerdasein einem Zweitberuf nachzugehen, etwa als Angestellter in einem Supermarkt oder als Wochenendkraftfahrer. Genossenschaften sind gut. Aber nur wenn sie qualitätsorientiert arbeiten können. Wenn nicht der Schwächste zum Mass der Dinge wird, sondern der Stärkste, Schönste, Beste. Wenn die Solidarität beflügelt, nicht bleischwer wiegt. Doch im Roussillon scheinen die Kooperativen, trotz bestem Willen, gerade einmal dafür sorgen zu können, dass es zu einem Schrecken ohne Ende kommt und nicht zu einem Ende mit Schrecken.
Die Kooperativen entstanden alle als Selbsthilfeorganisationen nach den blutigen Winzerunruhen von 1907, und deren Mitglieder bewirtschaften 90 Prozent der Rebfläche. Die unabhängigen Winzer sind in der Minderzahl und können in der ohnehin kleinen und damit mittellosen Region nicht – wie im Languedoc – auf eine starke Vermarktungsorganisation zählen, das Roussillon ist ausserhalb seiner Grenzen eine blosse Worthülse, die kaum für wirklichen Mehrwert sorgt.
Wer mit Schwierigkeiten kämpft, lässt sich besonders leicht in Versuchung führen. Darum ist Satan die wichtigste Figur in unserem Mysterienspiel. Er hat dafür gesorgt, dass das einzige echte Erfolgsprodukt der Region, der süsse Muscat de Rivesaltes, in den weinboomenden 70er und 80er Jahren zum Billig aperitif aus schäbiger Flasche verkommen ist, der bis heute die Regale der Supermärkte verstopft. Der stammt übrigens zu einem hübschen Teil aus den wenigen Rebbergen, die in der leichter zu bestellenden Ebene liegen, und verfügt über eine ausgezeichnete wie einheitliche Terroirstruktur.
Unter dem damals eingehandelten Imageschaden leiden heute noch alle Süssweine der Gegend, nicht nur der Muscat, sondern auch die (roten) Rivesaltes, die seit einigen Jahren in drei Varianten beziehungsweise Altersklassen auf den Markt kommen (Grenat, Tuilé und Ambré), sowie Banyuls, Banyuls Grand Cru und Maury.

Süss ist out
Auch Maury hat vor 20, 30 Jahren den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Statt aus dem guten inländischen Ruf für ihre gespriteten Süssweine Kapital zuschlagen, hat die Gemeinde bewusst darauf gesetzt, mit entsprechend geformten Flaschen ein Ersatzprodukt für Portwein anzubieten. Frankreich ist bis heute einer der grössten Importeure von Billigport – rund 15 Millionen Liter sind es jährlich, was ziemlich genau dem Inlandskonsum der in Frankreich selber produzierten gespriteten Süssweine entspricht, die zu 90 Prozent aus dem Roussillon stammen. Selbst die Herren von Banyuls, wie sie von den neidischen Winzern bezeichnet werden, die im restlichen Roussillon werkeln, verdienen ihre Brötchen mehr und mehr durch die Produktion von Ersatz in Form von Trockenem: Weisswein, Rosé und rotem Collioure.
Mit den trockenen Weinen sind wir direkt bei der zweiten Versuchung gelandet, der die Weinproduzenten im Roussillon ausgesetzt sind. Traditionell gesehen ist die Region Produzent von sogenannten natürlichen Süssweinen – Vin Doux Naturel (VDN) ist die staatlich abgesegnete Bezeichnung dafür, gemeint ist ein Wein, dessen Gärung durch Zugabe von Weinbrand auf natürliche Art und Weise gestoppt wurde, vergleichbar mit Portwein, Madeira und anderen ähnlichen längst aus der Mode geratenen Köstlichkeiten. Im 18. und 19. Jahrhundert war der Muscat de Rivesaltes einer der gesuchtesten Süssen der Welt, sein Ruf übertraf bei weitem den des ebenfalls süssen Banyuls. Abgesehen davon produziert die Region Weinbrand oder einfachsten Landwein meist für den lokalen Konsum. Spitzenweine aus dem Roussillon sind damit hauptsächlich die süssen Weine, die bis zu 80 Prozent der Gesamtproduktion ausmachen.
Doch gekauft werden diese heute nicht mehr. Darum bringen die Banyuls-Macher einen wachsenden Teil ihrer Produktion unter dem Namen der Nachbargemeinde auf den Markt. Und das geht so: Der süsse Banyuls kann in den drei Gemeinden Port-Vendres, Banyuls und Collioure erzeugt werden. Werden die Weine dieser Zone «trocken» ausgebaut, also ohne Gärstoppverfahren, heissen sie alle Collioure, ein marketingtechnisch geschickter Entscheid, geschickter als jener, der zur Schaffung der Appellation Maury Sec geführt hat, die seit 2012 für die trockenen Weine der Gemeinde Maury gilt. Die Winzer waren damals dagegen, die neue Regelung wurde von oben aufgezwungen. Stellen Sie sich nur vor, die unverstärkten Rotweine des Dourotals kämen ab sofort als «Porto trocken» auf den Markt…
Eldorado der Quereinsteiger
Der wichtigste der rund 40 privaten Weinbauern Maurys, Mas Amiel, hat trotzdem sofort reagiert und seine Produktion umgestellt. Er füllt bereits heute mehr trockenen als natursüssen Wein ab. Kurzfristig mag das richtig scheinen, doch letztlich heisst das einmal mehr: Statt auf ein zwar schrecklich unbequemes und darum ziemlich unverkäufliches, aber immerhin einmaliges und charaktervolles Original setzen zu können, muss der Erzeuger mit einem Kompromiss, einer Alternative überleben, an die er selber nicht so recht glaubt und die zudem die Botschaft einer historisch gewachsenen Marke verwässert. Winzer werden und sich ein paar Hektar Reben leisten kann im Roussillon jeder. Ausreissen kommt hier oft billiger als Weiterbestellen und Verkaufen noch billiger als Roden. Darum ist die Gegend zu einem wahren Eldorado für Quereinsteiger geworden.
Angefangen hat es mit Weinmissionaren aus dem übrigen Frankreich: Chapoutier und Gaillard in Banyuls, Thunevin und Calvet in Maury, Bizeul in Vingrau. Auf diese folgten Jungwinzer aus aller Welt. Sie bevölkerten ganze Weiler neu, besonders in den Côtes du Roussillon. Wer geblieben ist, hat der Gegend vor allem eines gebracht: ein besseres Image dank geschickterem Marketing, oft basierend auf den Vorteilen der Gegend – Sonne und Wind erleichtern wenigstens in den küstenferneren Gebieten, die weniger Probleme mit Unkraut kennen, den naturnahen Anbau. Dieser valorisiert die Produkte und erlaubt höhere Preise, die es braucht, um den Mangel an Ertrag auszugleichen. Das gilt übrigens nicht nur für den Weinbau: «Pyrénées Orientales» ist das Departement mit dem höchsten Anteil an Bioproduktion in ganz Frankreich. Die neuen Winzer haben sogar für einen kleinen Boom der Roussillon-Weine gesorgt, scheinbar wenigstens. Doch leider drücken ihre Weine nur selten den eigentlichen Charakter der Gegend aus – den ehrlich gesagt niemand genau kennt und über den sich selbst die Katalanen streiten. Die Weine gleichen einem Minervois oder Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Pic Saint-Loup, Valpolicella oder Amarone, machen auf Weltwein mit viel Holzeinsatz, spielen mit Muskeln, Extrakt und Feuer. Das kann man ihnen (den Winzern und den Weinen) nicht einmal verübeln. Denn wenigstens retten sie Rebberge vor dem Unkraut und Dörfer vor dem Ruin. Für das Image der Roussillon-Weine aber tun sie herzlich wenig, sie müssen – wohl oder übel – erst einmal sich selber verkaufen.
Die meisten Weinregionen haben ihre Apostel – Madiran hat Alain Brumont, die Rhône Chapoutier und das Languedoc Gérard Bertrand – nur im Roussillon fehlt ein solcher. Der Einzige, der es hier zu etwas internationalem Ruf gebracht hat, ist Gérard Gauby, und der ist erst einmal Gérard Gauby, zweitens Biopionier und drittens französischer Spitzenwinzer. Dass er im Roussillon sitzt, wissen die wenigsten. Schuld daran ist nicht Gauby, schuld daran ist das Roussillon selber. Denn zuerst einmal müssten die Katalanen selber zu Kreuze kriechen, etwas mehr Gemeinsinn an den Tag legen, etwas mehr Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten zeigen und in den wirklichen Reichtum der Gegend. Die Mauern zum Paradies würden damit zu Griesspudding, durch die man sich mit dem Löffel fressen könnte. Doch letztlich trägt auch Gott Mitschuld an dem Desaster, der die wenigen echt beseelten Winzer weiter Märtyrer spielen lässt, indem sie ihre Situation einfach ignorieren.
Denn der eigentliche Gott unserer Parabel sitzt nicht auf dem Roussillon-Hausberg Canigou. Er steht in Hamburg, Zürich oder Barcelona am Herd, kocht für seine Freunde ein Linsengericht und giesst soeben einen unpassenden Wein in die Karaffe. Er ist in Berlin, Bern oder London zu Hause und lässt schon wieder einfallslos einen «Tschardonney» in den Einkaufskorb plumpsen. Er wohnt in Rom, Warschau oder Wien und sucht im falschen Regal nach einem originellen Geburtstagsgeschenk für seine Liebste. Gott ist der Konsument. Der hat – von allerlei windigen Kellerpropheten angestiftet, zu denen auch wir gehören – alle störrischen Seraphim aus dem Weinkellerparadies vertrieben und lauscht nurmehr den demütig flötenden Cherubim, die unaufhaltsam die Passion vom Einheitsbrei verkünden.
Zum echten Glaubensbekenntnis gehört das grosse Pardon, das Erteilen der Absolution, der Sprung über den eigenen Schatten. Es nützt nichts, Satan als Messias zu rezyklieren. Lassen wir ihn einfach Luzifer sein, mit seinen guten und seinen schlechten Seiten. Wer dem Roussillon eine echte Chance geben will, akzeptiert seine Weine, wie sie wirklich sind: einmalig, urig, biblisch, charaktervoll, unbequem, störrisch, eckig, mürrisch, dickflüssig, körnig, feurig, süss – so himmlisch quer in der Landschaft und darum so teuflisch willkommen.