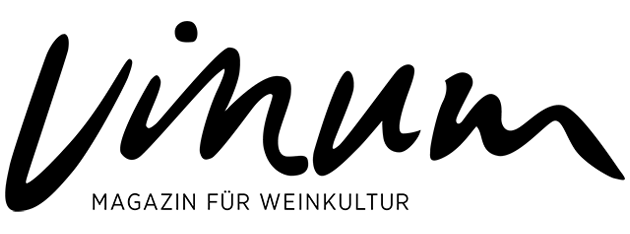Antikes Weinmachen
Wiederentdeckung der Langsamkeit
Text: Thomas Vaterlaus, Fotos: Linda Pollari
Es geht auch ohne glänzenden Edelstahl und digitalisiertes Hightech-Equipment. Einige der eigenständigsten und faszinierendsten Schweizer Top-Crus werden noch oder wieder mit fast antiken Methoden und Geräten gekeltert. Ein Foto-Essay.

«Alle rennen nach dem Glück. Das Glück rennt hinterher», heisst es in der Ballade von der Unzulänglichkeit in der «Dreigroschenoper» von Bertolt Brecht. Wer die Geschichte des Weinmachens, also der Keltertechnik, in einem Satz beschreiben möchte, muss im Zitat von Bertolt Brecht einfach das Wort «Glück» durch «Fortschritt» ersetzen. Denn war es wirklich «die grösste Revolution seit der vollständigen Frontalbegattung», wie es Baron Philippe de Rothschild in seiner Autobiografie schreibt, als 1933 die Elektrizität nach Château Mouton Rothschild kam? Und war es wirklich fortschrittlich, dass die Lehrer in den Schweizer Ausbildungsstätten dem Schweizer Winzer-Nachwuchs bis vor wenigen Jahren eintrichterten, dass akribische Kellerhygiene das Mass aller Dinge sei, sprich: ein mit Epoxidharz beschichteter Betonboden mit Entwässerungsrinne etwas Wunderbares sei, und ein altes Eichenfass mit allfälligen Bakterienstämmen eine potenzielle Gefahr? Tatsache ist, dass heute wieder immer mehr Winzer zum Schluss kommen, dass sich mit moderner Kellertechnik zwar zeitsparender, effektiver und letztlich wirtschaftlicher arbeiten lässt, dass wir aber, wenn es um die elementaren, nämlich die qualitativen Faktoren des Weinmachens geht, im Grunde nur wenig mehr wissen als die alten Griechen und Römer.

Ende Oktober am Ottenberg bei Weinfelden. Das Team vom Schlossgut Bachtobel hat sich minuziös auf den Pressgang im alten Torkel vorbereitet. Schon vor zehn Tagen wurde damit begonnen, das Pressbett aus Holz zu wässern, damit es dicht ist. Nun ist das Monstrum betriebsbereit. Der gewaltige Pressbalken wurde übrigens im Jahr 1584 aus Süddeutschland kräftesparend über den damals zugefrorenen Bodensee transportiert. Bereits beim Gang zum «Torggelgebäude» wird dem Besucher klar, mit wie viel ganzheitlichem Know-how hier schon vor hunderten von Jahren das Pressen konzipiert und durchgeführt worden ist. So wurden auf der Südseite des mächtigen Fachwerkbaus grosswachsende Bäume (heute sind es Platanen) gepflanzt, um den Torkelraum vor der warmen Nachmittagssonne zu schützen. Durch geschickt gesetzte Schlitze in den Wänden zirkuliert im Gebäude kühlende Luft. Und der von Dutzenden von Winzergenerationen festgestampfte Lehmboden sorgt für die nötige Luftfeuchtigkeit. Bis zur definitiven Stilllegung dieses Dinosauriers im Jahr 1976 wurde hier jede Bachtobel-Ernte gepresst. Mitte der 1990er Jahre liess Hans Ulrich Kesselring dann den alten Torkel restaurieren und presste hier fortan wieder regelmässig eine Charge seiner Pinot-Trauben.

Knarrende Magie
Johannes Meier und sein Team führen diese Tradition fort. Und das geht so: Zuerst werden rund 3500 Kilo durchgegorene Maische, von der schon rund 80 Prozent des Saftes frei abgelaufen sind, aus dem Gärtank in Bütten geschaufelt, dann auf dem Rücken in den Torkel getragen und dort vorsichtig im Pressbett aufgehäuft. Anschliessend wird die Maische mit Brettern abgedeckt, auf die dann wiederum Holzbalken so geschichtet werden, dass der Pressbaum anschliessend einen möglichst gleichmässigen Druck auf die Maische ausüben kann. Dann beginnen zwei Personen mit dem Drehen des Spindelholms und der Koloss setzt sich ächzend, knarrend und quitschend in Bewegung. Nach einigen Stunden wird die Maische umgeschichtet und nochmals gepresst. Sechs bis neun Stunden dauert so ein Pressgang. Die moderne, pneumatische Sutter-Presse im zeitgenössischen Kelterhaus vom Schlossgut Bachtobel braucht für einen Arbeitsgang dagegen nur zwei Stunden. «Der alte Torkel presst die Maische langsamer und mit konstanterem Druck sowie schonender, weil die Maische nicht bewegt wird. Zudem ist die Saft-Ausbeute rund 15 Prozent geringer als bei der modernen Presse», sagt Johannes Meier. Nicht messbar ist dagegen der Einfluss der ganz besonderen Mikroflora im alten Presshaus auf den finalen Wein. Der Magie der alten Technik und dem unnachahmlichen Duftgemisch aus altem Holz und kühler Erde kann sich jedenfalls kein Beobachter entziehen. Gerne möchten wir glauben, dass in so einer mystischen Aura ein besserer Wein entsteht als in modernen Kelterhäusern mit ihrer sterilen Atmosphäre und den digitalisierten Higtech-Geräten. Aber Johannes Meier ist realistisch: «Unser Eindruck ist heute, dass der fast 500-jährige Torkel einen zumindest ebenso so guten Presswein hervorbringt wie die moderne Presse, allerdings bei einem weitaus grösseren Arbeitsaufwand.» Und doch: Da die alte Presse im Bachtobel mechanisch kaum anders funktioniert als entsprechende Einrichtungen der alten Griechen und Römer, bleibt ein verblüffendes Fazit: Die Entwicklung der Presstechnik in den letzten 2500 Jahren hat zwar den Arbeitsaufwand reduziert, aber kaum einen Beitrag zu einer besseren Weinqualität geleistet… Die Bachtobel-Top-Selektion «No 3» des Jahrganges 2015 besteht übrigens zu 14 Prozent aus Saft von der alten Presse, und auch der 2016er «No 3» wird acht Prozent Presswein von diesem Torkel enthalten. In diesem Wein schwingt damit die ganze Geschichte, die ganze DNA dieses Ausnahme-Weingutes mit.

Das Ende der Gerle
Das vielleicht differenzierteste Zusammenspiel von urtraditioneller Kellertechnik und einem punktuellen Einsatz von modernen Methoden erleben wir in der Schweiz wohl im La Maison Carrée im neuenburgischen Auvernier. Die alten Holzfässer, das über Generationen gepflegte Werkzeug und vor allem die zwei Pressen aus dem Jahr 1804 sind beliebte Fotosujets. Doch das Konzept von Jean-Denis Perrochet beruht weder auf Romantik noch auf Folklore: «Wir bewahren das Alte nur, wenn es für uns aus qualitativen Überlegungen Sinn macht», sagt er, und um klar zu machen, wie er das meint, ergänzt er: «Würden wir im Keller noch mit Kerzenlicht arbeiten, wäre unser Wein deswegen nicht besser.» Für einen grossen, sehr bewusst gesetzten Bruch mit der Tradition entschied sich die Familie beispielsweise im Jahr 2011, als man bei der Ernte nicht mehr die alten Gerles einsetzte. Die Gerle ist ein 100 Liter fassender Maische-Holzbottich. Schon im Rebberg wurden auf diese Bottiche die Traubenmühle aufgesetzt, so dass die Gerles nicht mit Trauben gefüllt wurden, sondern bereits mit Maische. Solange im Oktober bei kühlen Temperaturen geerntet werden konnte, hatte das einen positiven Effekt. «Wir hatten schon eine gewisse Maischenstandzeit, bevor die Ernte in den Keller kam», sagt Jean-Denis Perrochet. Vor der Ernte mussten die aus Rottannen gefertigen Gerles jeweils gewässert werden, um sie dicht zu machen. 2003 war es erstmals während der Ernte so heiss, dass die Gerles zwischen den Erntegängen so austrockneten, dass Saft aus den Ritzen lief. Zudem begann der Saft teilweise schon zu gären, während die Gerles noch in den Rebgärten standen. Im ebenfalls sehr heissen Herbst 2009 wiederholten sich diese Probleme. Als sich 2011 die nächste heisse Ernte abzeichnete, musterten die Perrochets als letzte Winzerfamilie in Neuchâtel die Gerles aus. Seither werden die ganzen Trauben in 15-Kilo-Plastikboxen zum Keller gebracht, dort eingemaischt und nach einer kurzen gekühlten Maischenstandzeit gepresst und vergoren. «Es ging einfach nicht mehr, die Gerles waren einst für ein anderes Klima konzipiert worden», sagt Jean-Denis Perrochet.

Das Ende der Arbeitsepoche mit den Gerles hat Jean-Denis Perrochet aber auch klargemacht, dass jede Änderung in einem über Generationen fein abgestimmten Ablauf zwangsläufig nachfolgende Konsequenzen hat. Die Maische in den Gerles war jeweils schon im Rebberg leicht geschwefelt worden, um einen zu frühen Beginn der Gärung zu verhindern. «Mit dieser frühen, leichten Schwefelung wurde gewissermassen auch eine Selektion der natürlichen Rebbergshefen vorgenommen. Gewisse Hefestämme sind durch die Schwefelung nämlich abgestorben. Und vieles deutet darauf hin, dass eher problematische Hefen eliminiert worden sind und die guten Hefestämme überlebt haben.» Jetzt, wo die Trauben in Plastikboxen geerntet und erst im Keller in einer gekühlten Betonwanne eingemaischt werden, ist diese frühe Schwefelung nicht mehr nötig. Perrochet glaubt aber auch, dass er seither bei seinen Weissweinen, die ja fast unmittelbar nach der Ernte vergoren werden, nicht mehr über eine ganz so hochwertige Hefenkultur verfügt wie vorher.

Alte Presse – klarer Saft
Ganz traditionell erfolgt dann wiederum das Pressen der weissen Maische in den alten Korbpressen von 1804, die allerdings im Laufe der Jahrhunderte gezielt modernisiert worden sind. So besteht das Pressbett seit langem aus Beton, was in vielerlei Hinsicht praktischer ist. Im Gegensatz zu einem Pressbett aus Holz muss die Betonwanne nicht durch Wässerung dicht gemacht werden, und auch die nachfolgende Reinigung ist viel einfacher. Zudem verfügt die Spindel über ein Kugellager, was weniger Kraftaufwand erfordert. Und schliesslich wird der Pressdruck nicht nur mit Menschenkraft durch Drehen der Spindel erzeugt, sondern die Presse verfügt auch über eine Seilwinde, deren Kurbel mit einer zweifachen Übersetzung ausgestattet ist. 5000 Kilo weisse Maische fasst jede der zwei alten Pressen. Gepresst wird in zwei Phasen. Nach einigen Stunden wird die Maische nämlich neu auf einer kleineren Fläche, dafür aber höher geschichtet und mit Drainagen-Einschnitten versehen, damit der Saft besser ablaufen kann. Im Weisswein-Presshaus von La Maison Carrée sind während der Ernte zwei Männer ausschliesslich mit dem Pressen beschäftigt. Und die Verarbeitung einer einzigen Charge dauert einen ganzen Tag. Die Maische, die morgens angeliefert wird, ist abends zum gewünschten Saft geworden. Mit einer modernen Schlauchpresse könnte ein einziger Angestellter die gleiche Arbeit in zwei Stunden verrichten.

Und doch ist Jean-Denise Perrochet noch heute felsenfest davon überzeugt, dass die aufwändige Arbeit mit der alten Presse einen Saft ergibt, der qualitativ weitaus besser ist als das, was moderne Pressen mit ihrem künstlich forcierten Ablauf zu leisten vermögen. «Was bei uns schliesslich aus der Presse läuft, ist klarer Saft mit einem Schleimanteil von weniger als einem Prozent. Was moderne Pressen von sich geben, enthält dagegen bis zu 30 Prozent Schleimanteil», sagt Perrochet. Das heisst, mit einer modernen Anlage beginnt die Arbeit nach dem Pressen erst richtig, mit verschiedenen Eingriffen, um den trüben Most zu klären. «Wir dagegen haben das Privileg, den klaren Saft aus unseren Pressen von 1804 ganz schonend und praktisch ohne weitere Eingriffe in Wein transformieren zu dürfen.» Was uns Jean-Denise Perrochet damit sagen möchte: Beim Pressen des Weissweins bestand der Fortschritt in den letzten 200 Jahren wohl darin, Arbeitskraft einzusparen. Betrachtet man aber das Resultat, nämlich den Saft, der aus der Presse läuft, aus rein qualitativer Sicht, hat es keine Verbesserung gegeben. Im Gegenteil.