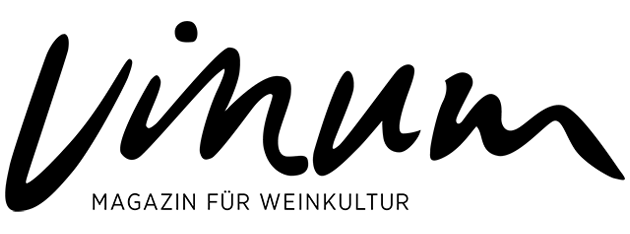Muscadet - Melon de Bourgogne
Mit Schirm, Charme und Melon(e)
Text: Birte Jantzen. Fotos: Emeline Boileau, z.V.g.

Man kennt den Muscadet vor allem als erfrischenden, sommerlichen Weisswein von der Atlantikküste. Dabei ist diese anscheinende Leichtigkeit lediglich eine der vielen Facetten dieses wandelbaren Weins, denn: Geboostet durch eine feinfühlige Terroir-Affinität, entpuppt sich seine Hauptrebsorte, die Melon, als würdige Erbin ihrer burgundischen Herkunft.
«Nehmen Sie es mir nicht übel, Thérèse, ich liebe Gewürztraminer, aber Muscadet passt besser zu Austern», deklarierte bereits Thierry Lhermitte im französischen Kinohit «Da graust sich ja der Weihnachtsmann». Er hatte vollkommen recht, denn: Muscadet scheint wie dafür geschaffen, Fisch und Meeresfrüchte mit delikaten Aromen und perfekt dosierter Frische ins rechte Licht zu rücken. Bei den Franzosen ist der Wein ebenso beliebt wie bei den Touristen, und so ist es kein Wunder, dass er von Frühling bis Herbst nicht nur an der französischen Atlantikküste reissenden Absatz findet. Wer sich jedoch mal näher mit den Weinen auseinandersetzt und, noch besser, in die puppige Gegend um Nantes reist, entdeckt schnell das bestens gehütete Geheimnis der Region: alte Jahrgänge, die auch nach 30 Jahren noch im Glas erstrahlen und eine unvermutete Komplexität an den Gaumen zaubern. Dies ist nicht nur dem Ausbau auf der Feinhefe zu verdanken, sondern auch den hiesigen vielfältigen, geologischen Gegebenheiten. Seit gut 15 Jahren werden diese immer präziser ins rechte Licht gerückt und geben dem Muscadet nun endlich auch offiziell eine Anerkennung, die er nur allzu sehr verdient.
Von reisenden Reben und gewieften Winzern
Nordöstlich bis südwestlich von Nantes gelegen, zieht sich die Weinregion Muscadet bis zum Atlantik, wo manche Rebberge Meerblick geniessen. Die Parzellen bevölkern eine Landschaft, geprägt von sanften Hügeln, Gehölzen, kleinen Dörfern mit spitzen Kirchtürmen und kuschelig versteckten, häufig schlossähnlichen Herrenhäusern, die im 18. Jahrhundert von der Aristokratie und der Bourgeoisie im Umland von Nantes erbaut wurden und den kuriosen Spitznamen «Folies Nantaises» erhielten, übersetzt «Verrücktheiten von Nantes». Es ist zu vermuten, dass manch einer beim Bau Originalität hat walten lassen und dabei wohl auch sein Vermögen nachhaltig verkleinerte.

Das ozeanische Klima und eine äusserst komplexe Geologie schufen dabei aber nicht nur ideale Voraussetzungen für Wochenendschlösser und botanische Gärten, sondern auch für einen Weisswein, dessen Geschichte eng verschlungen ist mit der Rebsorte namens Melon de Bourgogne, übersetzt «Melone des Burgund». Ein eher erstaunlicher Name für eine Traube, die so ganz und gar nicht nach Melone schmecken will und deren Werdegang sich liest wie ein Abenteuerroman mit dem Titel «Bye-bye Burgund».
Entstanden aus einer spontanen Kreuzung von Pinot Noir und Gouais Blanc, beide über Jahrhunderte als Gemischter Satz in den Weinbergen Ostfrankreichs gepflanzt, ist die Rebsorte Melon eine natürliche Schwester des Chardonnay und des Gamay. Ihr Name stammt wohl von der runden Form ihrer Blätter, obwohl auch die Weinbeeren selbst so rund sind wie Charentais-Melonen, nur eben viel kleiner. Das eigentliche Heimat-Terroir der Rebsorte ist das ehemalige Herzogtum Burgund, wo sie bereits im 13. Jahrhundert angebaut wurde. Wäre da nicht Philipp der Kühne, Herzog von Burgund, gewesen, würde sie dort vielleicht noch immer stehen: 1567 verbannte er per Erlass die beiden Rebsorten Gamay und Melon. Als absoluter Burgund-Purist begründete er dies damit, dass beide qualitativ nicht gut genug seien und das Niveau der Burgunder-Weine herunterziehen würden.

Ganz unrecht hatte er damit wohl nicht. Wie sich rückblickend herausstellte, entsprachen die Bodenbeschaffenheiten und das regionale Klima tatsächlich nicht so wirklich den idealen Bedürfnissen der beiden Rebsorten. Dem Gamay sollte es an den Schiefer- und Granithängen des Beaujolais wesentlich besser gefallen und dem Melon im ozeanischen Klima rund um Nantes und an der Atlantikküste. Allerdings brauchte es noch zwei weitere Erlasse in den Jahren 1700 und 1731, bis der Melon völlig aus dem Burgund zu verschwinden begann: Gewiefte Winzer des Herzogtums versuchten nämlich, mit Tricks den ursprünglichen Erlass zu umgehen. Sie stifteten erfolgreich Verwirrung (die zum Teil übrigens noch bis heute andauert), indem sie den Chardonnay einfach umtauften, zum Beispiel in Melon d’Arbois oder Melon à Queue Rouge. So wurde es schwierig zu unterscheiden, welche Rebstöcke genau herausgerissen werden sollten, und häufig traf es statt des Melon den Chardonnay!
Ab dem Spätmittelalter begann sich die Rebsorte entlang der Loire zu etablieren, unter anderem unter den Namen Muscadet oder Plant de Bourgogne. Sie akklimatisierte sich bestens, vor allem rund um Nantes, eine lebendige Stadt und ein wichtiger Flusshafen mit Zugang zum Atlantik. Im 17. Jahrhundert entdeckten die Flamen und die Niederländer die Qualitäten der Rebsorte und förderten ihren Anbau. Die eher delikate Aromatik, die Frische, aber auch der potenziell hohe Ertrag an Trauben waren optimal geeignet für die Herstellung von Branntwein, welcher international gehandelt und verschifft wurde. Es waren weder die glorreichsten noch die qualitativsten Jahrzehnte des Melon de Bourgogne.
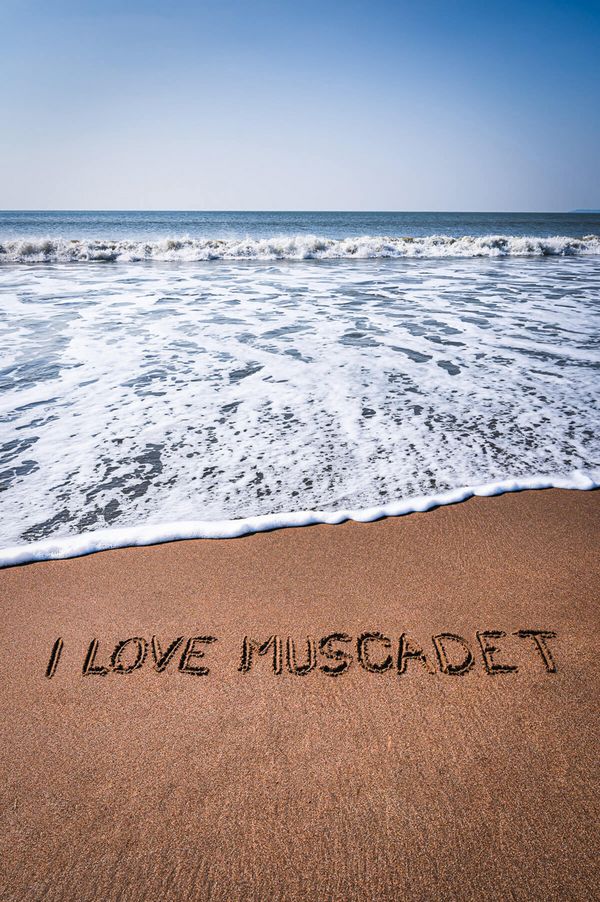
Letztendlich ist es wohl der Tragödie der Reblaus zu verdanken, dass der Melon doch noch, wenn auch spät, seinen Ritterschlag bekam: 1936 wurden die geschützten Ursprungsbezeichnungen AOP Muscadet Sèvre et Maine und AOP Muscadet Coteaux de la Loire ins Leben gerufen, 1937 die AOP Muscadet und, allerdings erst 1994, die AOP Muscadet Côtes de Grandlieu. Alle vier waren und sind noch immer ganz und gar dem Melon de Bourgogne gewidmet.
Der Wein des Muscadet gilt schon lange als Inbegriff von Sommer, Frische und Atlantik-Flair. Ab den 1990er Jahren wurde dieses Image äusserst erfolgreich vermarktet, und die Kenntnis von seiner Lagerfähigkeit verfiel in den Dornröschenschlaf. Mittlerweile kämpft sich das Terroir jedoch wieder zurück ins Rampenlicht, und mit ihm die gesamte Ausdrucksvielfalt der Rebsorte.
Es war einmal ein Hochgebirge...
Das Terroir des Muscadet gehört zum Armorikanischen Massiv, einem uralten Grundgebirgskomplex, zu dem auch die Bretagne und ein Teil der Normandie gehören. Die Besonderheit: Ehemals ein über 4000 Meter hoher Gebirgszug, ist davon heute nichts mehr zu sehen. Über zwei Millionen Jahre hinweg verwandelte er sich in eine sanfte Hügellandschaft, deren höchster Punkt heutzutage gerade einmal 417 Meter über dem Meeresspiegel liegt.

Das beträchtliche Ausmass der Schiebebewegungen der Krustenebenen sowie die Altersunterschiede der Gesteine führten in der gesamten Zone zu einer aussergewöhnlichen geologischen Vielfalt. Der Süden des Massivs wird durchzogen von der Loire und ihren Zuläufen, so auch der Sèvre und der Maine, und beeinflusst vom ozeanischen Klima des Atlantiks. Hier hat der Melon de Bourgogne rund um Nantes ein passendes Zuhause gefunden. Die Bodenbeschaffenheiten, bestehend aus plutonischen und metamorphischen Gesteinen, bedeckt von einer meist dünnen, kargen und wasserdurchlässigen Sedimentschicht, schaffen ideale Bedingungen, um den kristallinen Charakter der Rebsorte perfekt herauszukitzeln. Nachdem die Anbaufläche je nach Marktnachfrage immer wieder dem Jo-Jo-Effekt unterlag, ist sie heute strikt auf 6700 Hektar begrenzt, in mehr oder minder steilen Hanglagen.
Von Anfang an wurden bei der Gründung der unterschiedlichen AOPs des Muscadet geografische Besonderheiten beachtet. Über die folgenden Jahrzehnte kamen geologische dazu. Heute gibt es zehn geografische Abgrenzungen, die stets mit besonderen Bodenbeschaffenheiten und dementsprechend individuellen Wein-Stilistiken einhergehen.

Gib mir die Feinhefe!
Nicht nur das Terroir beeinflusst den Charakter der Weine: Während die meisten Winzer für die Gärung mittlerweile mit modernen Stahltanks arbeiten, findet der Ausbau der Weine zum Grossteil noch immer in unterirdischen, traditionell mit Glaskacheln ausgelegten Betontanks statt. Dank der Erde perfekt isoliert, bleibt deren Temperatur auch über lange Zeit auf natürliche Weise stabil und frisch – ganz nach dem Prinzip der georgischen Qvevri. Es ist wunderbar nachhaltig und energiesparend.
Doch der Clou des Ganzen liegt woanders: nämlich im langen Ausbau auf der Feinhefe. Sie «nährt» den Wein, gibt ihm Struktur, Textur und Komplexität und verwandelt das Potenzial des Terroirs in Lagerfähigkeit. Dank der filigranen Natur des Melon bleiben die Weine dabei delikat und voller Leichtigkeit, auch in wärmeren Jahrgängen. Dies ist auch einer der Gründe, warum Holzfässer nur selten zum Einsatz kommen: Weder die oxidativen noch die aromatischen Noten, die das Holz mit sich bringt, passen zur feinen, zarten Eleganz der Weine. Ihre meist salzig-zitronige Lebendigkeit braucht keinerlei Artefakt, und so kommen die gekachelten, gut isolierten Betontanks sehr gelegen.
Zwar gibt es Muscadets auch fast ohne Ausbau auf der Feinhefe – das sind dann die Sommerweine, die an der Atlantikküste reissenden Absatz finden –, aber die meisten verweilen zwischen sechs und neun Monaten auf ihr. Mit geografischer Bezeichnung sind es sogar 18 bis 24 Monate, und je nach Laune des Winzers bleiben manche noch wesentlich länger auf der Feinhefe.

Warum eigentlich der Name Muscadet?
Wer Muscadet liest, denkt wahrscheinlich als Erstes an Muskateller, jene Rebsorten, deren intensives Bouquet an Rosenduft, exotische Früchte, Orange und orientalische Gewürze erinnert. Der Melon de Bourgogne ist jedoch in keiner Weise mit ihnen verwandt. Warum also diese Parallele? Bis zur Reblausplage im 19. Jahrhundert standen auf den meisten Parzellen mehrere Rebsorten, gepflanzt als Gemischter Satz. Als Muscadet galten jene, auf denen der Melon zusammen mit der weissen Rebsorte Folle Blanche wuchs. Dies erlaubte, den Melon später und reifer zu ernten, zusammen mit der Folle Blanche, die auch reif noch immer genügend Frische mitbrachte. Das ergab einen Wein mit blumigen Noten, Aromen von Zitrusfrucht und reifem Pfirsich, allerdings in einer mineralischeren Stilrichtung, als es der Muskateller je sein könnte.
Nach der Reblausplage wurde jedoch entschieden, den Melon nur noch allein zu pflanzen. Nicht in jedem Jahrgang wurden die Trauben perfekt reif, und so bekam der Muscadet eine puristische, eher salzig-zitronige Stilistik. Heute, dank der Klimaerwärmung und eines präziseren Managements der Weinberge, sind auch die expressiveren Aromen zurück. Hinzu kommt, dass der Muscadet seit gut 15 Jahren einen beeindruckenden Wandel hingelegt hat. Anfang der 2000er Jahre erschütterte eine heftige Krise seine Grundfesten, vergleichbar mit der heutigen Krise des Bordeaux. Es wurde beschlossen, die qualitativ minderwertigsten Parzellen herauszureissen, die Anbaufläche wurde halbiert und die Qualität der Weine machte einen klaren Sprung nach vorne.

Interessant und ungewöhnlich ist, dass es im Muscadet nie Winzergenossenschaften gegeben hat. Waren es vor allem grosse Weinproduzenten wie Castel und Grands Chais de France, die dem Muscadet den Ruf eines leichten Sommerweins verpassten, haben Winzer wie zum Beispiel Joseph «Jo» Landron (Domaine Landron), Jérôme Bretaudeau (Domaine Bretaudeau), Pierre Luneau-Papin (Domaine Luneau-Papin) oder Jean-Jacques Bonnet (Domaine Bonnet-Huteau) bewiesen, dass der Melon de Bourgogne auch gross sein kann. Sie erfanden die Stilistik der Weine neu, befreiten sie aus dem Korsett des leichten Sommerweins, interpretierten die Vielfalt des Terroirs und zeigten den anderen Winzern der Region neue Horizonte und Wege.
Heute ist der Muscadet so vielfältig und spannend wie nie. Bei all den Veränderungen ist jedoch eines konstant geblieben: seine magische Liebesbeziehung zu Fisch, Austern und Meeresfrüchten. Die älteren, auf Feinhefe ausgebauten Muscadet passen zudem auch wunderbar zu fein zubereitetem Geflügel, Jakobsmuscheln oder Ravioli mit Champignons und Parmesan. Es ist ein Wein, der beim Reifen lange jugendlich bleibt, selbst in den einfacheren Varianten.

Und auch (wein-)touristisch hat die Region Muscadet viel zu bieten. Auf den alten Werften von Nantes beeindruckt das Kunstprojekt «Les Machines de l’Ile» mit seinen überdimensionalen, marionettenartigen, poetischen Maschinen. Im Herzen des Muscadet, bei Vertou, heisst im Sommer das Château de la Frémoire Besucher willkommen und schenkt auf seiner einladenden, familienfreundlichen Terrasse Muscadet in allen Varianten aus.
Wer es italienisch mag, findet in Clisson nicht nur lagerfähigen Muscadet, sondern auch ein wunderhübsches Dorf mit einer italienisch geprägten Architektur, die es erlaubt, sich fröhlich zwischen der Toskana und dem Muscadet hin- und herzubeamen. Vergessen darf man natürlich auch nicht das ikonische Hellfest, ein dreitägiges Open-Air-Hardrock-Festival, Headbanging und Muscadet-Weinbar inklusive. Mit anderen Worten: Das Muscadet ist in jeder Hinsicht eine Entdeckung wert!