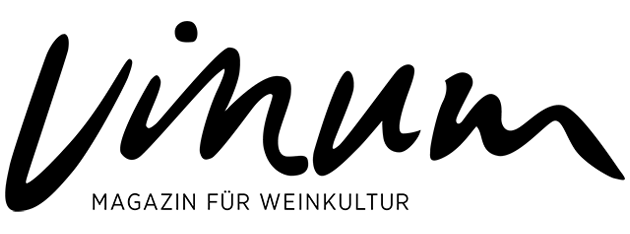Die Deutschschweiz im Lagen-Fieber
Alles Lage oder was?
Text: Thomas Vaterlaus, Fotos: Siffert / weinweltfoto.ch

Von Basel bis Graubünden boomen Einzellagen-Selektionen, vorzugsweise aus Chardonnay und Pinot Noir. Für viele Winzer sind diese Crus heute die qualitativen Visitenkarten ihres Schaffens. Kritiker bemängeln das Fehlen von objektiven Kriterien zur Bewertung solcher Lagen und sprechen generell von einem Wildwuchs, der die Konsumenten überfordere. Verkostungen von Lagenweine zeigen aber: Die Crus verleihen dem Deutschschweizer Weinbau durchaus neue, faszinierende Facetten
Rund 90 Reblagen mit eigenständigen Flurnamen sind im entsprechenden Verzeichnis des Kantons Graubünden aufgeführt. Zusammengetragen wurden sie vor rund 30 Jahren vom Verein Kultur Herrschaft. Dieses Register ist heute die Grundlage von rund 40 Lagenweinen, die abgefüllt werden. Tendenz steigend. Für neue Dynamik in der Szene sorgte etwa in Malans die Familie von Salis, deren spektakuläre Einzellagen Bothmerhalde und Küng seit kurzem von Wegelin und Fromm vinifiziert und als Crus vermarktet werden. «Immer mehr Winzer in der Deutschschweiz möchten Burgund spielen, doch ob das Lagenkonzept in Schaffhausen, im Aargau oder in Graubünden eine ähnliche Berechtigung hat wie in der vielzitierten Vorbildregion, ist aus meiner Sicht eine bisher nicht ausreichend beantwortete Frage», sagt Martin Donatsch. Sein Einwand bezieht sich nicht nur auf den Einfluss des Terroirs auf den Wein, sondern auch auf die wirtschaftliche Bedeutung solcher Crus. Im Burgund umfasst der grösste Grand Cru, der Corton-Charlemagne, eine Rebfläche von annähernd 160 Hektar, das ist mehr als ganze Winzerdörfer in der Bündner Herrschaft, im Aargau oder in Schaffhausen aufweisen. So gesehen können die neuen Crus aus Kleinstlagen, von denen es jährlich nur ein paar hundert Fläschchen gibt, dem Deutschschweizer Weinbau nur bedingt zusätzliches Renommee verleihen, schon gar nicht auf internationaler Ebene. Viel eher führen sie zu einer zusätzlichen Zersplitterung des aus vermarktungstechnischer Sicht eh schon sehr kleinräumig strukturierten Weinschaffens in der Deutschschweiz mit insgesamt gerade mal 1600 Hektar Reben.
Noch nicht bereit für die Lage?
Thomas Studach in Malans, bekannt dafür, dass er beim Kundtun seiner Meinung kein Blatt vor den Mund nimmt, kann der LagenEuphorie nicht viel Positives abgewinnen: «Vielleicht können wir in der Bündner Herrschaft so in hundert Jahren mal seriös über den Einfluss der Lage auf den Wein diskutieren. Bis dahin sollten wir aber vielleicht zuerst mal klären, wie stark die Wahl der Unterlagsreben, der Klone und des Erziehungssystems unsere Weine prägt», sagt er. Zudem hätten die verschiedenen Schuttkegel in der Bündner Herrschaft zwar durchaus unterschiedliche Böden ergeben, er hält aber das Terroir innerhalb eines Schuttkegels im Vergleich zu Rebbergsböden in anderen Regionen für vergleichsweise homogen. Sein Fazit: «Der Einzellagen-Trend ist sicher eine coole PR-Story, manche Winzer können stundenlang über ihre Crus parlieren, ob die Weine aber auch ohne diese Erklärungen als wirklich eigenständig wahrgenommen werden, kann ich bis heute nicht beurteilen.»

Der oft zitierte Vergleich der Lagenanhänger mit dem Burgund hinkt aber auch bei einem anderen zentralen Punkt. Denn das dortige Klassement verknüpft die exakte Herkunft der Weine mit einer qualitativen Einstufung in Grand Cru, Premier Cru und Village-Wein. Noch komplexer ist der kürzlich gestartete Klassifikationsprozess für die Erste Lage und, darauf aufbauend, die Grosse Lage in Österreich. Dokumentationen zur historischen Bedeutung und zur Homogenität von Boden, Klima und Ausrichtung sind ebenso erforderlich wie ein belegtes Qualitätspotenzial in Form von nationalen und internationalen Weinbewertungen. Aber auch die Vermarktungsmenge und das Preisniveau der Weine werden berücksichtigt. «In einer ernstzunehmenden Klassifizierung können die Winzer nicht einfach selbst entscheiden, was eine Toplage ist, sondern es braucht hierfür eine multifaktorielle Betrachtungsweise», sagt Michael Moosbrugger, der als Obmann der Österreichischen Traditionsweingüter eine Vorreiterrolle bei der Lagendiskussion innehatte. In der Schweiz gibt es bisher nur ein Klassement, das ähnlich umfassend und streng ausgestattet ist, nämlich jenes für die Premiers Grands Crus im Waadtland.
Im Vergleich dazu erscheinen die Anforderungen an einen Lagenwein in der Deutschschweiz eher rudimentär. Die verschiedenen Rebbaukommissäre verlangen vom Winzer einzig die Bestätigung, dass die entsprechend gekennzeichneten Weine tatsächlich aus den betreffenden Flurgebieten stammen. In Bezug auf die Qualität gelten mehrheitlich die allgemeinen AOC-Bestimmungen. Selbst allfällige Zusatzbezeichnungen wie «Selektion» oder «Auslese» sind kaum an strengere Bestimmungen geknüpft. Trotzdem gehören Lagenselektionen von Weingütern wie Fromm, Wegelin oder Adank in der Bündner Herrschaft, Besson-Strasser in Zürich oder Tom Litwan im Aargau gegenwärtig zum Besten, was in der Deutschschweiz aus Pinot Noir und Chardonnay in die Flaschen kommt. Dies bestätigen zahlreiche VINUM-Verkostungen in den letzten Jahren. Daraus lässt sich folgern, dass die Motivation des Winzers, mit seinem Lagenwein ein qualitatives Ausrufezeichen zu setzen, der weitaus bessere Qualitätsgarant ist als ein komplexes Regelwerk.
Crus benötigen ein Profil
Seit Jahren etablierte Lagenweine wie etwa der Kloster Sion Klingnau Pinot Noir Reserve der Familie Meier in Würenlingen, der Spätburgunder Stadtberg vom Weingut Pircher in Eglisau oder der Pinot Noir Selvenen vom Weingut Fromm in Malans verfügen durchaus über ein eigenständiges und somit erkennbares sensorisches Profil. Eine besondere Rolle spielen diesbezüglich die Pinot-Noir-Selektionen 1 (Basiswein) bis 4 (Parzellen-Selektion) vom Schlossgut Bachtobel in Weinfelden. Alle Rebberge dieses Schlossgutes befinden sich nämlich innerhalb der im kantonalen Register definierten Lage Bachtobel. Somit ist es das einzige Weingut in der Deutschschweiz, das aus einer klassifizierten Einzellage anhand einer Qualitätspyramide vier abgestufte Weine in die Flaschen bringt. Sehr komplex und anspruchsvoll ist die Abgrenzung der einzelnen Crus bei Winzern wie Tom Litwan oder den Herrschäftler Weingütern Fromm, Wegelin oder Adank, die inzwischen von jedem Jahrgang Kollektionen von Cru-Weinen auf den Markt bringen. Selbst Fachleute haben bei Blindproben oft Mühe, die Weine den entsprechenden Lagen zuzuordnen.
«Es dürfen nicht die Winzer allein entscheiden, was eine Toplage ist.»
Michael Moosbrugger, Obmann ÖTW
Doch dies ist, nicht zuletzt infolge der Klimaerwärmung, auch im Burgund zusehends schwieriger geworden. Auch hier kann es bei gewissen Jahrgängen schon mal vorkommen, dass der Romanée-Saint-Vivant sensorisch und qualitativ verblüffend nahe beim Romanée-Conti liegt. Oder wie es Tom Litwan formuliert: «Ein Lagenwein bleibt auch dann ein Lagenwein, wenn der Konsument den eigenständigen Charakter des Crus nicht erkennen kann. Allein schon die Tatsache, dass der Wein von einem exakt definierten Ort stammt, gibt dem Gewächs einen Mehrwert.» Winzer wie Georg Fromm oder Tom Litwan arbeiten bei ihren Crus konsequent darauf hin, den Ausdruck der Lage so unverfälscht wie möglich in die Flaschen zu bringen. Die Basis dazu ist der kontrolliert biologische Anbau. Ebenso wichtig ist es, dass die Begrünung individuell an jede Parzelle angepasst wird. Tiefe Einsaaten schlüsseln dabei die Böden so auf, dass die Reben animiert werden, tiefe Wurzeln zu bilden. Im Keller verfolgen beide Winzer einen minimalistischen Ansatz, Vergärung mit rebbergseigenen Hefen, Verzicht auf Filtration und zurückhaltende Schwefelung sind Standard. Mit strengen Ansätzen wie diesen verleihen Lagenweine der Weinbauszene in der Deutschschweiz durchaus eine zusätzliche, sprichwörtlich tiefgründige Dimension.

Besser Village als Cru?
Noch nicht abschliessend geklärt scheint jedoch die Frage zu sein, ob die im Trend liegenden Einzellagen in jedem Fall der Weisheit letzter Schluss sind oder ob nicht auch der Fokus auf die in den letzten Jahren eher vernachlässigten Grosslagen (etwa Fläscher Halde, Buechberg im St. Galler Rheintal oder Ottenberg in Weinfelden) interessante Ansätze bieten könnte. Das Gleiche gilt für Dorfweine nach dem burgundischen Village-Konzept. Im 2017 erschienenen Standardwerk «Stein und Wein» wird aufgezeigt, dass die Bündner Herrschaft aus geologischer Sicht zweigeteilt ist. Im nördlichen Abschnitt werden die Böden von der steil abfallenden Kalkwand des Fläscher Bergs geprägt. In der Ebene dominiert hier der Kalkschutt, der sich über die Jahrtausende vom Fels gelöst hat. Weiter im Süden bestehen die diversen Bachschuttkegel dagegen mehrheitlich aus Sand, Kalk und Ton. Das zentrale Phänomen ist der nach Süden zunehmende Tongehalt in den Rebbergen. Die vom Kalk geprägten Weine in Fläsch zeigen sich tendenziell elegant und filigran. In Jenins, wo sich Kalk und Ton mischen, und besonders in Malans, wo der Ton dominiert, entstehen hingegen dichtere, fülligere und auch würzigere Weine.

Village-Weine aus Fläsch, Jenins oder Malans könnten so gesehen verschiedene Terroir-Stilistiken repräsentieren, ähnlich wie im Burgund, wo die Côte de Beaune für einen eher filigraneren Pinot-Typ steht, während an der Côte de Nuits tendenziell vollere und komplexere Crus entstehen. Solche Differenzierungen anhand von etwas grösser gefassten Rebgebieten wären für die Konsumenten wohl griffiger und besser zu verstehen als in Form von verschiedensten Parzellenselektionen aus den gleichen Dörfern. Dass der Fokus auf solche grösseren Rebbergseinheiten in Bezug auf Renommee und Marketing interessante Perspektiven eröffnen kann, zeigt sich im Waadtland am Beispiel des 16 Hektar umfassenden Calamin und des 54 Hektar grossen Dézaley, die 2013 beide vom Kanton zu Grands Crus gekürt worden sind. Vor allem der Dézaley, der zudem schon 2007 ins Weltkulturerbe der Unesco aufgenommen worden ist, geniesst nationales und internationales Ansehen. Beide Grands Crus profitieren davon, dass hier zahlreiche Winzer ihre gleichnamigen Grand-Cru-Selektionen aus der Sorte Chasselas auf den Markt bringen.
«Die exakte Herkunft gibt jedem entsprechend gekennzeichneten Wein einen Mehrwert.»
Tom Litwan, Winzer im Aargau
Damit steigern sie mit vereinten Kräften das Image dieser Paradelagen. Auch in Schaffhausen, im Aargau, in Zürich, im Thurgau oder in Graubünden gibt es Grosslagen, die das Potenzial hätten, in ähnlicher Weise zu Aushängeschildern des Deutschschweizer Weinbaus zu avancieren, quasi als die grossen starken Brüder der Selektionen aus kleinen Einzellagen. Trotz der gegenwärtigen Lagen-Euphorie beweisen Topwinzer wie Martin Donatsch, dass auch lagenunabhängige Qualitätspyramiden hervorragend funktionieren können. Donatsch arbeitet nun schon seit über 20 Jahren sehr erfolgreich mit den Qualitätsstufen «Tradition», «Passion», «Unique» und «Privée», was ihm die Chance gibt, sein Traubengut immer wieder jahrgangsspezifisch zu selektionieren. «In unseren vor allem klimatisch unsicheren Zeiten ist das für mich der bessere Weg. Was machst du, wenn du über Jahre hinweg einen Pinot-Lagenwein als dein Flaggschiff-Produkt etabliert hast und dann erkennen musst, dass die Lage inzwischen zu warm ist, um einen Top-Pinot zu erzeugen? Klar, du kannst auf eine höhere Lage umsteigen, aber bis dieser neue Cru dann wieder das Renommee seines Vorgängers erreicht hat, verstreichen locker zehn Jahre.»
Ja zur Lage
Georg Fromm, Malans

Er hat mit seinem Cru-Konzept schon im neuseeländischen Marlborough ein neues Kapitel Weinbaugeschichte geschrieben. Seit 20 Jahren wiederholt er nun diese Erfolgsstory im heimischen Malans. Als ersten Cru hat er damals den Schöpfi-Wingert, einen von Mauern umfassten Clos, separat ausgebaut und abgefüllt. Danach folgten die Einzellagen-Selektionen Selvenen, Fidler, Spielmann und Michel sowie ab dem Jahrgang 2024 als bisher sechster und letzter Cru der Küng, eine der ältesten Wein-Gemarkungen im Dorf. Alle sechs Terroirs verfügen über eine individuelle Bodenbeschaffenheit, wobei in den höheren Lagen wie Selvenen der Anteil von Schiefer und Gestein höher ist, während in niedrigeren Lagen wie Fidler oder Spielmann mehr Humus oder Sand zu finden sind. Zudem sind die Parzellen mit verschiedenen Pinot-Klonen bepflanzt, und das Alter der Reben ist unterschiedlich. Mit der Umstellung auf kontrolliert biologischen Anbau ist Fromm überzeugt, den Lagen-Charakter noch stärker herausarbeiten zu können, vor allem, weil er die Einsaat-Mischungen für die Begrünung auf den jeweiligen Bodentyp abstimmt. Bei der Vinifikation verzichtet er auf Interventionen wie etwa die kühle Maischenstandzeit vor der Gärung und setzt auf eine möglichst natürliche Vinifikation mit rebbergseigenen Hefen. Mit diesem ausgeklügelten, burgundisch inspirierten Konzept entstehen Weine, welche die Vielschichtigkeit des Malanser Terroirs subtil aufzeigen.
Tom Litwan, Oberhof

Was hat den Stadtzürcher Tom Litwan in die aargauische Provinz gelockt? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen: «Der Kalkmergelboden. Ich kenne keinen anderen Ort in der Deutschschweiz mit so uralten, völlig ausgewaschenen, kargen Böden, in denen die Burgundersorten ihre Qualitäten so subtil ausspielen können.» Kein Wunder, dass er sein Terroir ehrt, indem er es biodynamisch bewirtschaftet und bis zu sechs Lagen-Pinots mit Namen wie Wanne, Auf der Mauer, Chraibel oder Rüeget produziert. Jeder Cru hat ein eigenständiges Profil. Mögen sich die Böden nur in Nuancen unterscheiden, so hat im komplex kupierten Hügelland doch jede Parzelle ihr eigenes Mikroklima. Und auch wenn alle Litwan-Crus mit ihrem trockenen, frischen und belebenden Charakter begeistern, so zeigt sich der Rüeget stets besonders mineralisch, filigran und lebendig, während der Auf der Mauer kraftvoller und samtiger erscheint, bedingt durch die wärmespeichernden Trockensteinmauern, welche hier die Rebterrassen halten. Und der Chalofe ist mit seiner ebenso eleganten wie vielschichtigen Art vielleicht der wohlproportionierteste, der vollkommene unter den Litwan-Crus. Könnte er sich vorstellen, hier auch mit einem lagenunabhängigen Selektionssystem zu arbeiten? «Vorstellen kann man sich sowas schon, aber es würde mich in keiner Weise interessieren.»
Nein zur Lage
Martin Donatsch, Malans

«Wenn ich verfolge, was in Bezug auf Lagenweine in der Herrschaft abgeht, erinnere ich mich daran, dass wir das ja vor 50 Jahren auch mal gemacht haben und aus guten Gründen wieder davon abgekommen sind», sagt Martin Donatsch. Tatsächlich war es sein Vater Thomas Donatsch, der in den 1980er und 1990er Jahren mit Einzellagen-Selektionen wie Frassa, Selvenen oder Spiger das Thema der Crus lancierte. Mit dem Jahrgang 2005 haben sie dieses Kapitel wieder abgeschlossen. Ende der 1990er Jahre wurde bei der Erstellung des Lagenverzeichnisses festgestellt, dass ein kleiner Teil des Weins, den die Donatschs als Spiger abfüllten, eigentlich aus der benachbarten Lage Michel stammte. So hätten sie fortan zwei Weine keltern müssen. «Da ist uns klar geworden, dass wir mit einem zu kleinräumigen Denken nicht weiterkommen. Wir haben darum unsere eigene Qualitätspyramide aus «Tradition», «Passion», «Unique» und «Privée» gebaut», erzählt Martin Donatsch. Auch sein Vater, ein überzeugter Anhänger der burgundischen Denkweise, stand voll hinter diesem Kurswechsel. Angesichts der nationalen und internationalen Nachfrage und dem damit zusammenhängenden Marktwert von «Unique» und «Privée», der heute bei Auktionen definiert wird, war es sicher die richtige Entscheidung. «Wir haben heute die Freiheit und Flexibilität, um bei Chardonnay und vor allem Pinot Noir kompromisslos auf die Qualität zu fokussieren. Und das ist auch sehr ehrlich gegenüber dem Kunden. Egal von welchem Klon, unabhängig von jungen oder alten Reben sowie der Lage: Das Beste, was wir am Schluss im Keller haben, soll auch zum höchsten Preis verkauft werden. Warum es kompliziert machen, wenn es doch eigentlich so einfach ist?»
Martin Wolfer, Weinfelden

Die Tatsache, dass sich die etwas mehr als zehn Hektar Reben, die Martin Wolfer am Ottenberg bewirtschaftet, auf drei Parzellen in drei verschiedenen Lagen verteilen, gibt ihm beste Voraussetzungen, um Lagenweine aus seiner Leitsorte Pinot Noir zu selektionieren. Vor allem, weil die Parzelle Bründlerberg, wo auch die Kellerei steht, doch die poröseren Böden aufweist als Waidli und Bachtobel mit ihrem tonig-lehmigen Untergrund. Trotzdem arbeitet Martin Wolfer seit 15 Jahren mit einer lagenunabhängigen Qualitätspyramide, bestehend aus den Stufen «Classic», «Selection» und «Grand Vin». Der Grund dafür: Wolfer baut in seinem Keller seit vielen Jahren sowohl die Parzellenweine als auch die Pinot-Klone separat aus. «So bin ich zur Überzeugung gekommen, dass der Klon den Wein hier am Ottenberg stärker prägt als die Lage.» Seinen Basiswein, den «Classic», keltert er ausschliesslich aus dem lockerbeerigen, aber spät reifenden Mariafeld-Klon. Für den «Selection» kommen Wädenswiler Klone (vor allem Klon 2/45 FAW1) zum Einsatz. Sein Flaggschiff-Gewächs, der «Grand Vin» entsteht vollumfänglich aus kleinbeerigen Burgunderklonen. Seinen Topwein bietet er seit einigen Jahren übrigens auch in gereifter Form an, das heisst nach siebenjähriger Flaschenreife. Dafür legt er jedes Jahr rund 500 Flaschen zurück. Während sich immer mehr Deutschschweizer Topwinzer am «Tanz um die Lagen» beteiligen, zeigt Martin Wolfer, dass die optimale Trinkreife ein mindestens ebenso interessantes Thema sein kann.
Mehr Mut zur Grösse!
Einzellagen-Weine stehen in der Deutschschweiz für Exklusivität auf hohem Niveau, werden aber leider nur in minimalsten Mengen produziert. Im Waadt-land beweisen dagegen die beiden stattlichen Grand-Cru-Lagen Dézaley und Calamin, dass Grosslagen mehr Wirkung erzielen können, vor allem, weil sie mit Crus von verschiedenen Winzern im Markt vertreten sind. Auch in der Deutschschweiz gäbe es Grosslagen mit Potenzial. Vier Beispiele.
Ottenberg (TG)

Es ist die Paradelage für Pinot Noir im Thurgau. Der Ottenberg ist ein rund 56 Hektar umfassender, topografisch sehr homogener Südhang im oberen Thurtal, der sich zwischen den Gemeinden Märstetten und Weinfelden erstreckt. Vor allem die vier Weingüter Schloss Bachtobel, Michael Broger, Martin Wolfer und die Familie Burkhart bringen hier Pinot-Selektionen in die Flaschen, die auch gesamtschweizerisch in der Topliga spielen. Die Böden werden an der Oberfläche von schwerem, lehmreichem Humus geprägt, darunter befindet sich ein komplexes Gemisch von Gesteinen (etwa Nagelfluh, Sandstein, Mergel, vermischt mit Kalk), welches die Gletscher bei ihrem Rückzug vor circa 20 000 Jahren hinterlassen haben. Auch die Ottenberger Winzer tendieren zu Selektionen aus Einzellagen wie Bachtobel (Schloss Bachtobel), Schloss (Familie Burkhart) oder Schnellberg (Michael Broger). Die übergeordnete Bezeichnung «Ottenberg» wird auf den Labels kaum verwendet, obwohl die Lage, wenn sie gemeinsam kommuniziert werden würde, in Bezug auf Prestige und Renommee des Anbaugebietes einen Mehrwert generieren könnte.
Fläscher Halde (GR)

Sie ist eine der spektakulärsten Grosslagen in der Bündner Herrschaft: Die 32 Hektar umfassende Fläscher Halde und die angrenzende Lage Bad (circa 6 Hektar) reichen bis zur Felswand des Fläscher Berges. Der Hangschutt hat hier ein sehr sandiges, mit Ganey- und Sandschiefer durchsetztes Terroir geschaffen, das einzigartig ist in der Bündner Herrschaft. In den höheren Lagen reifen die mithin besten Chardonnays Graubündens. Aber auch der Pinot überzeugt trotz des vergleichsweise warmen Mikroklimas dank der speziellen Bodenstruktur mit Finesse und Eleganz. Der Pinot Noir Sélection Bovel von Daniel und Monika Marugg ist seit Jahrzehnten der Inbegriff eines hochkarätigen Crus von der Fläscher Halde. Einzellagen-Selektionen wie Spondis oder Herrenacker von Patrick Adank stehen dagegen für eine eher kernigere, fordernde Stilistik. Insgesamt können in der Fläscher Halde rund zehn Einzellagen ausgewiesen werden. Obwohl Winzer zunehmend zu diesen Einzellagen tendieren oder ihre Weine unter Fantasiebezeichnungen in Verbindung mit der AOC Graubünden vermarkten, wird die Bezeichnung «Fläscher Halde» kaum verwendet. Dabei benennt sie ein Rebgebiet mit homogenem Charakter bezüglich Boden und Mikroklima, das eigenständige Weine hervorbringt.
Buechberg (SG)

Der mit einer Fläche von 24 Hektar grösste zusammenhängende Rebberg im Kanton St. Gallen schiebt sich als letzter Riegel in west-östlicher Ausrichtung zwischen das Appenzeller Land und den Bodensee. Im Herzstück befindet sich der Steinig Tisch mit dem Restaurant und der Aussichtsplattform über einem spektakulär senkrecht abfallenden Sandfelsen, darunter liegen die aufwendig zu bewirtschaftenden Reb-steillagen. Die Stöcke wurzeln in sandhaltigen Lehmböden. Das Klima in Seenähe ist mild, die vielen Trockensteinmauern speichern zusätzlich die Wärme, so dass heute auch Merlot und Malbec ausreifen. Renommierte Weingüter wie Roman Rutishauser (Weingut Steinig Tisch in Thal), die Familien Wetli in Berneck und Herzog in Thal sowie der Ochsentorkel (Tom Kobel), ebenfalls in Thal, bewirtschaften hier Rebberge. Weil die Gebietsbezeichnung Buechberg auch in Schaffhausen und anderen Kantonen vorkommt, werden die Weine hier zumeist unter anderen Bezeichnungen vermarktet. So kommt der Top-Pinot-Noir von Roman Rutishauser nicht unter «Buechberg» auf den Markt, sondern trägt den Namen der Einzellage «Lüchli». Eigentlich schade, denn der topographisch spektakulär anmutende Hügelzug könnte ein Aushängeschild im St. Galler Weinbau sein.
Stadtberg Eglisau (ZH)

Endlich mal eine Grosslage, die in den letzten Jahren eine Erfolgsgeschichte hingelegt hat. Noch vor 20 Jahren war der 16 Hektar umfassende Eglisauer Stadtberg auf den Labels kaum mehr präsent. Viele Trauben verschwanden in AOC-Zürich-Abfüllungen, und sogar das Paradegut des Städtchens, das Weingut Pircher, brachte seinen Topwein nur mehr unter dem Sortennamen Pinot Noir auf den Markt. Heute nennt sich dieser Paradewein wieder stolz Sélection Stadtberg, während Mathias Bechtel, der sich in den letzten Jahren hier als zweiter Spitzenwinzer etabliert hat, seine Pinots als «Grand Cru Eglisau» vermarktet. Viel zur Renaissance beigetragen hat die kürzlich mit hohem ökologischem Anspruch realisierte Melioration im Vorderen Stadtberg. Ausgleichsflächen mit einer 600 Meter langen Wildblumenböschung, Magerwiesen, eingesenkte Steinhaufen und Strauchgruppen sorgen für Nachhaltigkeit. Besucher können über zwei öffentliche Treppen mitverfolgen, was sich in diesem «Weinberg der Zukunft» so alles tut. Der ruhig dahinfliessende Rhein, das mittelalterliche Städtchen und der Stadtberg dahinter bilden ein einmaliges Ensemble, für das die neuen Stadtberg-Crus die besten Botschafter sind.