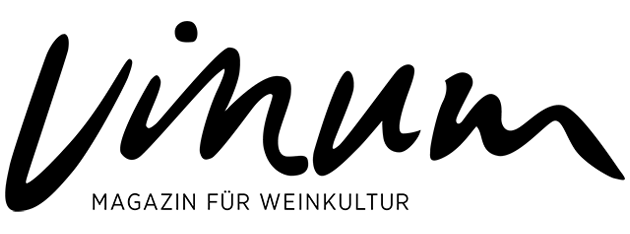Klein, aber oho! Warum Grösse nicht alles ist
Die besten Miniwinzer Deutschlands
Text: Patrick Hemminger

Sie bewirtschaften winzige Weinberge und machen aus den Trauben teilweise grosse Weine. Deutschlands Miniwinzer – wie sie ticken, wie sie überleben und warum Grösse nicht alles ist.
Am Anfang war es Hardcore
Weinmanufaktur Alois Metz
76863 Herxheim bei Landau,
Pfalz, Rheinland-Pfalz
www.weinmanufaktur-metz.de
Im Herbst steht Alois Metz noch lieber auf als sonst. Dann geht er als Erstes in die Garage. Dort gärt sein Wein, «und das ist der beste Geruch, den ich kenne», versichert der 59-Jährige. Den kennt und liebt der Winzer schon seit seiner Kindheit. Sein Vater hatte 20 Kilometer von Herxheim entfernt einen Kriegskameraden. Dort holte er frischen Most und vergor diesen zu Hause selbst zu Wein – zumindest zu etwas Ähnlichem. «Unser Haustrunk», sagt Metz. «Trüb, braun und oxidativ, das war schon Hardcore.» Trotzdem weckte das, was da in den Fässern geschah, die Begeisterung von Metz.
Metz setzte auf pilzwiderstandsfähigen Sorten
Nach der Schule lernte er erst Bankkaufmann, dann Bankbetriebswirt und arbeitete 20Jahre lang als Vorstandsmitglied der Volksbanken-Raiffeisenbanken. Damals baute er sein erstes Haus, und als es darum ging, die Einfahrt zu bepflanzen, kamen für ihn nur Reben infrage. 25 Rebstöcke der pilzwiderstandsfähigen Sorten (Piwi) Phoenix und Sirius gaben schon bald Most für Metz’ erste Versuche. Auch bei seinen vier älteren Brüdern pflanzte er Reben, so dass er auf 250 bis 300 Liter pro Jahr kam.
«Am Anfang habe ich alle möglichen Fehler gemacht: kein Pflanzenschutz, sämtliche Trauben gelesen, bei 60 bis 70 Grad Öchsle, also mit sehr wenig Zucker in den Beeren. Kein Wunder, dass die Weine blass und dünn waren», gesteht Metz ein. Zudem roch sein erster Versuch 1994 stark nach faulen Eiern. Die meisten Menschen, denen Metz einen Schluck zum Probieren anbot, winkten ab. «Ein paar haben gesagt, der riecht erbärmlich, aber wir trinken mit dir. Die bekommen heute noch jedes Jahr eine Flasche von mir», erzählt Metz. Nach diesem ersten Versuch ging er nach Neustadt an der Weinstrasse in eine Buchhandlung und kaufte Fachbücher für Winzerlehrlinge. Im Urlaub arbeitete er sich durch sie durch, verstand er etwas nicht, fragte er einen Winzer. So wurden die Weine allmählich besser. «Ich würde sagen, ab Ende der 1990er Jahre, also so nach vier, fünf Jahren, waren sie trinkbar», sagt Metz. Jeden Tag trafen sich die fünf Metz‘schen Brüder in ihrem Elternhaus. Dort hatten sie in die ehemalige Scheune eine Weinstube gebaut, und tranken Abend für Abend ihren Feierabendschoppen zusammen, sonntags von zehn bis zwölf gab es Frühschoppen. So hätte es weitergehen können.
Die Sorten Solaris und Cabaret Noir bewährten sich
Aber 2010, mit gerade mal 50 Jahren, erkrankte Metz so schwer, dass er in den Ruhestand ging. «Eineinhalb Jahre später ging’s mir wieder besser. Da hatte ich die Idee, mehr und besseren Wein zu machen», erzählt Metz. Zwei Jahre dauerte es, bis er am Ortsrand auf einem Viertel Hektar seine Reben setzen konnte. Wieder waren es Piwis und zwar die Sorten Solaris, die unter anderem Gene von Riesling und Grauburgunder enthält, und Cabaret Noir, bei der der Hauptanteil vom Cabernet Sauvignon stammt.
Aus beiden keltert Metz in seiner Garage ernst zu nehmende Weine, die längst weit mehr sind als ein Haustrunk und die er auch verkauft. Von der Qualität zeugen auch die Auszeichnungen, die er beim Internationalen Piwi-Weinpreis bekommen hat. Dabei ist bei Metz alles Lowtech. Die Temperatur bei der Gärung etwa steuert er, indem er nachts das Garagentor öffnet und kühle Luft hineinlässt. Sein Ruf als Piwi-Winzer ist inzwischen weit über Herxheim hinaus gedrungen. «Jeden Monat habe ich Kontakt mit Menschen aus halb Europa, die Fragen zu diesen Sorten haben», sagt Metz. «Das freut mich sehr.»
Free Solo an der Mosel
Weingut Jakob Tennstedt
56841 Traben-Trarbach,
Rheinland-Pfalz
www.jakobtennstedt.de
«Ich habe alle Zweifel über Bord geworfen und einfach losgelegt», sagt Jakob Tennstedt. Wenn es in Deutschland einen Preis für den mutigsten Winzer gäbe, dann wäre der 33-Jährige ein ganz heisser Kandidat für den Sieg. Vor vier Jahren kam er an die Mosel. Sein Ziel: Spitzenweine zu keltern. Er investierte alles, was er hatte, in eineinhalb Hektar Weinberge, pachtete einen Keller und eine Halle, kaufte gute Holzfässer, eine hochwertige Presse, eine Pumpe und fing an. Dabei war der Weg als Moselwinzer alles andere als vorgezeichnet.
Vom Koch in Italien zum Weinbaustudent in Geisenheim
Tennstedt ist gebürtiger Berliner. «Schon in der Schule war mir klar, dass ich nicht studieren möchte. Ich wollte immer was mit den Händen machen», erklärt er. So machte er eine Kochlehre in der Sternegastronomie. Aber das war auch nicht das, wonach er suchte. «Mir war das zu international und zu luxuriös», sagt er. Tennstedt zog es zu den Grundlagen. Die besten Produkte einer Region auf die für sie beste Weise zuzubereiten, das wollte er lernen. Und wo geht das besser als in Italien? Tennstedt packte seine Sachen, reiste über die Alpen, lernte und kochte in Osterien. Sein Plan war, das ganze Land zu bereisen, überall zu arbeiten und jede regionale Küche kennenzulernen. Aber dann kam der Wein dazwischen. Deutsche Rieslinge von Mosel und Nahe faszinierten Tennstedt so sehr, dass er dann doch noch studierte, und zwar Weinbau in Geisenheim.
Gesucht und gefunden: Die Mosel
Danach machte er sich auf die Suche nach einem Ort, wo er mit wenig Geld selbstbestimmt etwas aufziehen konnte. Und er fand die Mosel. «Hier bekommt man die besten Lagen halb geschenkt», findet er. Immer weniger Winzer tun sich die Knochenarbeit in den Steillagen an. Tennstedts Weinberge liegen im Kautenbachtal, einem Nebental der Mosel im Hunsrück. Seine Reben sind bis zu 100 Jahre alt, viele davon wurzelecht. Tennstedt war selbst überrascht, wie freundlich ihn die Menschen an der Mosel aufnahmen, ihn, den Quereinsteiger und -denker. «Ich bin mit offenen Armen empfangen worden», freut er sich. «Auch von den alten Winzern war jeder freundlich zu mir.» Schnell wurde er Mitglied beim Klitzekleinen Ring, einer Vereinigung von einem Dutzend haupt- und nebenberuflichen Winzer. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, den historischen Steillagen an der Mosel wieder mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Selbstbestimmtes Arbeiten bedeutet, alleine zu arbeiten. Und da Tennstedts Weinberge alte Steillagen sind, wo er alles von Hand machen muss, hat er mit eineinhalb Hektar genug zu tun, will vielleicht sogar wieder schrumpfen. Das geht natürlich nur, wenn die Qualität enorm ist und die Preise dementsprechend sind. Tennstedts Einstiegs- und Erstlingswein, der «Sternentaucher», kostet im Handel bereits mehr als 30 Euro. Dass das gerechtfertigt ist, erreicht er, indem er im Weinberg penibel alles mit der Hand macht und im Keller dann so gut wie nichts mehr. Die Weine liegen bis zu drei Tage auf der Maische und vergären spontan in 1000 Liter fassenden Moselfudern. Auf der Vollhefe bleiben sie so lange, bis sie stabil sind. Dann kommen sie unfiltriert und ohne Schwefel in die Flasche. Fertig.
Gemeinsam klein
Weinmanufaktur Kasel
54317 Kasel, Rheinland-Pfalz
www.weinmanufaktur-kasel.com
«Mal stirbt einer weg, mal kommt einer dazu. Aber unter dem Strich sind wir konstant so bei 13 Mitgliedern», sagt Gerhard Biewer. Er ist hauptberuflich Verwaltungsleiter im Priesterseminar des Bistums Trier, «kein wachsender Markt», wie Biewer feststellt. Dazu ist er erster Vorsitzender der kleinsten Genossenschaft Deutschlands, der Weinmanufaktur Kasel. Die liegt im Tal der Ruwer, nicht weit entfernt von so klangvollen Nachbarn wie Reichsgraf von Kesselstadt oder Karlsmühle.
Gegründet wurde die Genossenschaft 1934 aus der Not heraus. Reine Weingüter gab es nicht. In klassischen Mischbetrieben wurde neben Viehhaltung und Landwirtschaft ein bisschen Wein gemacht. «Gegen Ende des Herbstes zogen dann die Kommissionäre über die Dörfer und kauften für die grossen Kellereien Wein ein», erzählt Biewer. «Kurz vor dem Winter brauchten die Landwirte Geld und so mussten sie für kleines Geld verkaufen.» Es gab keine Transparenz, kaum einer wusste, wie viel ein Dorf weiter gezahlt worden war. Damit wollten die Landwirte Schluss machen und taten sich zusammen, um gemeinsam und stärker auftreten zu können.
Gemeinsam bewirtschaften die 13 Mitglieder etwa dreieinhalb Hektar
In den 1970er und 1980er Jahren gaben viele der kleinen Betriebe auf. In den Städten liess sich nun leichter leben und mehr Geld verdienen, an der Mosel lagen viele Flächen brach. «Hier in Kasel war das nicht so das Problem. Die grossen Betriebe haben die freien Flächen aufgesogen. In den Nachbarorten sind die Weinberge oft ein übler Flickenteppich», konstatiert Biewer. «Etwa die Hälfte von uns macht heute als Nebenerwerb Wein», sagt er. Da die Genossenschaft alles in Flaschen vermarktet, ist das ein nettes Zubrot. Die andere Hälfte ist aus Spass am Weinmachen dabei. «Wir haben einen Professor von der Uni in Trier und einen Luxemburger Banker, der eine Auszeit nimmt», berichtet Biewer. Das Praktische am Nebenerwerb sei, dass alle Mitglieder noch etwas anderes können als Weinmachen. «Wir haben einen Webdesigner dabei, einen Kaufmann, einen Elektriker und einen Kellermeister, das ist praktisch», fasst Biewer zusammen. Gemeinsam bewirtschaften die 13 Mitglieder etwa dreieinhalb Hektar. Das grösste Mitglied ist mit einem Hektar der Kellermeister, das kleinste hat 183 Quadratmeter. «Der kann mit drei Waschbütten alles lesen», schmunzelt Biewer.
Die Weine der Genossenschaft bestehen fast nur aus Riesling, die meisten jenseits von Trocken. Und das zu sehr verbraucherfreundlichen Preisen, alles kostet weniger als einen Zehner. Immer am Samstagvormittag hat der Weinverkauf der Kellerei geöffnet, jeder hat mal Verkaufsdienst. Biewer freut sich sehr darüber, wer da alles kommt. Nach Kasel sind in den vergangenen Jahren viele junge Familien gezogen, «die kommen mit dem Kinderwagen vorbei und legen die Flaschen unten rein».
Vom guten Leben im Italien des Ostens
Weingut Grober-Feetz
06632 Freyburg, Sachsen-Anhalt
www.grober-feetz.de
Die Rechnung von Stephanie Grober-Feetz und Tino Feetz aus Freyburg (Unstrut) im Weinbaugebiet Saale-Unstrut ist einfach: Von hundert Flaschen verkaufen sie 50 im eigenen Ausschank, 35 kaufen die Gäste für zuhause und nur 15 gehen an Gastronomen. So kann die Familie gut von ihrem gerade mal 2,1 Hektar grossen Weingut leben.
Die Geschichte des jungen Betriebs beginnt eigentlich schon in den 1980er Jahren, zu Zeiten der DDR. Tino Feetz war Kradmelder bei der Nationalen Volksarmee (NVA) und kam mit seiner Einheit mal durch die Region. «Auf einmal haben wir schöne Weinberge gesehen. Es sah aus, als hätten wir uns verfahren und wären in Italien gelandet», erzählt er. Nach dem Zusammenbruch der DDR arbeitet er kurze Zeit bei der Wismut im Uranbergbau. «Als das zu Ende ging, das war 1991, habe ich mir gesagt: ‹Jetzt hast du Zeit, fahr doch noch mal in die Gegend›», sagt Feetz.
Die ersten Weine konnten sie bei Bernhard Pawis ausbauen
Zufällig war gerade Lesezeit und die Genossenschaft in Freyburg suchte Erntehelfer. Sieben Tage die Woche, Tag für Tag zwölf Stunden wurde damals gearbeitet. «Da hat man gut verdient als junger Mensch», gibt Feetz zu. Als die Lese vorbei war, blieb Feetz. Er arbeitete im Keller, im Lager, fuhr Wein aus. Bis er 2002 bei Bernhard Pawis anfing. Pawis war schon damals und ist heute noch einer der besten Winzer vor Ort. Die beiden lernten viel mit- und voneinander. Aber vor allem lernte Feetz dort Stephanie Grober kennen, die eine Ausbildung zur Winzerin machte. Die beiden wurden ein Paar. Schon damals hatte Feetz ein paar Rebstöcke, die Weine konnte er bei Pawis ausbauen. Bald war der Plan, daraus ein richtiges Weingut zu machen. 2012 beendete Stephanie Grober-Feetz ihre Lehre bei Pawis. «Dann wollte ich mich selbstständig machen», sagt sie. Dass im gleichen Jahr ihr erster Sohn zur Welt kam, hielt sie nicht auf – der Kleine war von Anfang an in den Weinbergen mit dabei. 1,2 Hektar hatten sie inzwischen, im Hof und Garten ihres Fachwerkhauses in der Altstadt machten sie ihren Wein. 1300 Flaschen gab es vom ersten Jahrgang 2012, die verkauften sie an Freunde und Bekannte.
Gastwirtschaft in einer alten Mühle
In den Jahren danach geschah vieles: Die beiden nahmen weitere Weinberge dazu, kauften und renovierten eine alte Mühle, in die sie eine Gastwirtschaft einbauten. Dort stehen Grober-Feetz und ihre Mutter in der Küche. «Wir begleiten den Wein vom ersten bis zum letzten Handgriff. Das wollen wir dem Gast alles nahebringen», betont Grober-Feetz. «Mir war klar, dass wir da Essen mit anbieten müssen.»
Beim Weinmachen sind die Aufgaben klar verteilt: Feetz ist draussen in den Weinbergen, inzwischen sind es 2,1 Hektar, wo er fast jeden Rebstock persönlich kennt und alles von Hand macht, selbst den Pflanzenschutz. «Ich kenne schon die Stöcke, an denen die Krankheiten losgehen. Deshalb spritze ich nur, wenn ein Befall da ist, nie vorher», stellt Feetz klar. Seine Frau macht die Arbeit im Keller. Dort stehen etwa 50 Edelstahltanks von 60 Liter bis 1000 Liter. Das Weingut hat – typisch für Saale-Unstrut – eine Menge Rebsorten. «Wie viele?», fragt Grober-Feetz, «Da muss ich selbst überlegen…ich sag’ 17, mein Mann sagt 19», meint sie. «Von manchen haben wir gerade mal zehn Stöcke, da ist die Frage, ob man die mitzählt», sagt Feetz. Das bringt mit sich, dass sie mit verschiedenen Jahrgängen bis zu 50 Weine im Verkauf haben. 15'000 bis 20'000 Flaschen füllen sie im Jahr. Weil sie so viele davon direkt an Endkunden verkaufen, können sie gut davon leben. «Ich habe auf einem Lehrgang mal gehört, dass, wenn man fünf Jahre besteht, man durch ist», verrät sie. «Also haben wir’s geschafft.»
Burgund an der Mosel
Weingut Daniel Twardowski
54347 Neumagen-Drohn,
Rheinland-Pfalz
www.pinot-noix.com
Daniel Twardowski ist eigentlich Weinhändler. Er kauft und verkauft Raritäten aus dem Burgund und dem Bordelais. Als Twardowski 15Jahre alt war, zog seine Familie nach Saarburg an der Saar. «Das war so die Zeit, als es mit Mädels losging und man hier und da mal ein Bier probiert hat», sagt Twardowski. Aber er merkte bald, dass man in seiner neuen Heimat kein Bier trank und fast jeder Weinberge in der Familie hatte. Und er merkte, dass er den Wein ziemlich lecker fand. «So zu Abi-Zeiten waren wir eine Clique, die freitags und samstags nicht in die Disco gegangen ist, sondern sich zum Kochen oder Essengehen getroffen hat», führt er aus. Bald probierte er seine ersten Weine aus dem Burgund und dem Bordelais. Für einen Schüler waren die damals schon teuer, und so kam er auf eine Idee: «Ich habe zwei Kisten gekauft. Eine Flasche habe ich behalten und elf für den Gesamtpreis weiterverkauft», sagt er. Daraus entwickelte sich allmählich ein richtiger Handel, den er auch während seines BWL- und Marketingstudiums weiter betrieb. «Nach dem Studium habe ich gedacht: Das läuft gut, das mache ich weiter», sagt Twardowski.
Pinot Noir statt Riesling an der Mosel
Ein paar Jahre später, Mitte der Nullerjahre, lockte ihn dann aber etwas anderes immer mehr: «Ich wollte einen Weinberg haben», sagt er. «Ich musste was für meine Figur tun und wollte all das, was ich über Wein wusste, selber umsetzen.» Er bekam knapp 0,25 Hektar in einer Toplage angeboten und legte los. Aber nicht mit dem für die Mosel typischen Riesling, sondern mit Spätburgunder. «Hier stimmen alle Parameter, wir haben die richtigen Böden und das richtige Klima», hebt er hervor. Dazu kommt das richtige Rebmaterial. Durch seine guten Beziehungen zu Winzern im Burgund, stehen heute in seinen inzwischen drei Hektar Weinbergen Reben, die aus den besten Domänen dieser Region kommen, auch seine Fässer bezieht er von dort. «Und dann hatte es mich gepackt», sagt Twardowski. Etwas Schöneres als die Arbeit im Weinberg konnte er sich nicht mehr vorstellen. So ist er inzwischen noch zu etwa 30 Prozent Weinhändler, die restlichen
70 Prozent Winzer.
Keine Herbizide
Auf den Einsatz von Herbizid verzichtete Twardowski von Anfang an. Nicht weil es zum Zeitgeist passte. «Ich war schon damals davon überzeugt, dass nur in einem gesunden Boden gesunde Reben wachsen und nur diese gute Trauben ergeben», schildert er. Das macht die Arbeit in der Steillage natürlich nicht einfacher. Vier Mitarbeiter hat er, und bei dieser Grösse soll es bleiben. «Wenn man so arbeitet, kannst du nicht wachsen, wohin du willst. Wer soll die ganze Arbeit machen?», fragt er. Deshalb verdient er sich mit seinem Weingut auch keine goldene Nase, wie er betont – und das trotz eines Flaschenpreises von 70 Euro. «Darum geht es mir aber auch nicht, ich habe eine Botschaft: Wir können hier an der Mosel Rotwein machen. Und man kann Rotweine mit weniger als 13 Prozent Alkohol machen und das sind trotzdem keine dünnen Pfützchen.»
Die Laura will’s doch machen!
Kore – Wein & mehr
67146 Deidesheim, Rheinland-Pfalz
www.kore-wein.de
Laura und Fabian Kerbeck sind Pfälzer durch und durch. Sie war mal Weinprinzessin, ein Grossvater hatte einen Weinberg, bei ihm sogar beide. «Die Zeit der Lese war immer ein grosses Familienfest, alle haben geholfen», sagt Laura Kerbeck. Nach ihrer Zeit als Weinprinzessin war ihr klar, dass sie etwas mit Wein machen wollte. Auch ihr Mann wusste schon recht bald, was sein Beruf werden sollte. «Ich wollte hier in der Gegend bleiben und was mit den Händen machen», betont er. Weinbau lag da nahe, und nach ein paar Praktika war er sich sicher. Unabhängig voneinander entschieden sie sich für ein Studium an der Uni Geisenheim. Er wollte Weinbau studieren, sie internationale Weinwirtschaft. Und als das schon feststand, lernten sie sich – ganz pfälzisch – auf einem Weinfest kennen.
Der Gedanke an eigene Weinberge oder gar ein eigenes Weingut war da noch weit weg. «Das kam gar nicht von uns», erzählt die 28-jährige Laura Kerbeck. «Ein Winzer aus der Gegend hatte den letzten Weinberg meines Opas nach dessen Tod bewirtschaftet und wollte dafür gerne einen Pachtvertrag. ‹Weil die Laura will’s ja eh nicht machen›, meinte er. Und da dachten wir uns: Warum eigentlich nicht?»
Spätburgunder statt Portugieser
14 Ar, also gerade mal 1400 Quadratmeter, ist die Parzelle gross. Damals stand dort Portugieser. Den haben die beiden seitdem nach und nach durch Spätburgunder ersetzt. Dazu kam bald noch ein halber Hektar Riesling aus Fabian Kerbecks Familie. «Wir hatten einfach Lust drauf. Wir haben gesagt, wir probieren’s und schauen, wohin die Reise geht», bekennt der 29-Jährige. Qualitativ geht die Reise auf jeden Fall nach oben. Was die Jungwinzerin und der Jungwinzer seit 2015 in die Flasche bringen, ist beeindruckend und steht dem vieler etablierter Weingüter nicht nach. Die Weine sind wie die beiden selbst: bodenständig und typisch pfälzisch. Einen Orange Wine wird es von Kore nicht geben, auch keinen teuren Spitzenwein. «Wir wollen nicht abheben, ich will mir den Wein selber leisten können», betont Laura Kerbeck. Derzeit dürfen sie ihre Weine – 2018 waren es rund 4000 Flaschen – in dem Betrieb ausbauen, in dem beide angestellt sind.
Dabei wird es vorerst auch bleiben. Langsam zu wachsen ist schwierig. Irgendwann wären eine eigene Immobilie und eigene Maschinen nötig. «Aber für wenig Menge viel Equipment zu kaufen, lohnt sich nicht», meint Fabian Kerbeck. Wenn, dann müsste es gleich eine Betriebsgrösse sein, von der die beiden leben könnten. Aber so ein Weingut ist in der Gegend rund um Deidesheim, wo die beiden wohnen, teuer. Und eigentlich wollen sie auch lieber einen Bauernhof. «Wein ist Genussmittel», sagt Laura Kerbeck. «Wir haben Lust, auch andere Nahrungsmittel selbst anzubauen.»
Wein brachial
Konni & Evi – Weingut Buddrus
06636 Laucha, Thüringen
www.konniundevi.de
Mit einer Nachricht auf dem Handy fing alles an. «Mein Schwager hat mir einen Link zu einer Anzeige geschickt, dass in der Nähe ein Weinberg zu verkaufen ist», berichtet Konrad Buddrus, genannt Konni. In der Nähe, das heisst bei Naumburg an der Saale, wo Buddrus aufwuchs. Da war er gerade in Veitshöchheim (Franken) und machte dort seine Ausbildung zum Weinbautechniker. Ausserdem hatte er seine Freundin Eva-Maria Wehner, genannt Evi, kennengelernt. Die beiden packten ihre Sachen und zogen 2017 ins nördlichste deutsche Weinanbaugebiet: Saale-Unstrut.
Biodynamischer Weinbau auf 2,5 Hektar
Mit 0,3 Hektar ging es los, alte Rebstöcke Silvaner, Müller-Thurgau und Portugieser. Die 30-jährige Eva-Maria Wehner ist Grundschullehrerin und fand in Weißenfels eine Anstellung, Buddrus stieg für vier Tage die Woche als zweiter Kellermeister beim Weingut Herzer ein. «Den Rest, also Freitag, Samstag, Sonntag und die Feierabende widmen wir uns unseren eigenen Reben», führt der 25 Jahre alte Buddrus aus. Die wurden schnell mehr. Inzwischen bewirtschaften die beiden zweieinhalb Hektar, aus denen sie mit sehr niedrigen Erträgen von gerade mal 20 Hektoliter pro Hektar faszinierende Naturweine keltern. «Wir bekamen so schöne Steil- und Terrassenlagen angeboten, da konnten wir nicht nein sagen», erzählt Buddrus. Aber da er ohnehin nirgendwo lieber ist als zwischen Reben, passt ihm das gut. «Das wird nie langweilig. Wenn der Tag 48 Stunden hätte, dann wäre das auch okay», sagt er. Viel mehr Fläche kann es bei dem Aufwand, den die beiden betreiben, gar nicht werden. Sie sind von Demeter zertifiziert, bewirtschaften ihre Weinberge nach biodynamischen Richtlinien.
Extreme Naturweine
Die Weine sind extrem, selbst für die Naturweinszene – etwa der Portugieser von 2018 mit gerade mal zehn Volumenprozent Alkohol und brachialer Säure oder der ebenso leichte, dabei enorm würzige und säurebetonte Silvaner. «Wir lesen die Trauben mit einer Idee, wir messen da nicht rum», erläutert Buddrus. «Wir pflücken hundert Beeren von verschiedenen Stellen im Weinberg und an verschiedenen Stellen der Reben. Die pressen wir aus, und wenn uns der Saft schmeckt, dann lesen wir.» Ausgebaut wird alles im Holz, die Fässer sind aus Harzer Eiche. Diese Detailverliebtheit hat ihren Preis. Los geht das Buddrus-Sortiment bei knapp 20 Euro. Das bringt mit sich, dass den beiden die Weine in der Region nicht gerade aus den Händen gerissen werden. 70 Prozent gehen ins Ausland, in die coolen Weinbars und Restaurants in London und Paris, in die Niederlande, nach Kanada und Dänemark. Was die Zukunft bringen soll, mehr Fläche, mehr Spielereien beim Ausbau oder andere Rebsorten, da machen Konni und Evi sich keine Gedanken. «Wir sind nicht so die Planer», gesteht Buddrus. «Dinge ergeben sich oder nicht. Ich kann nicht mal zwei Woche im Voraus planen. Wir machen einfach unser Ding.»