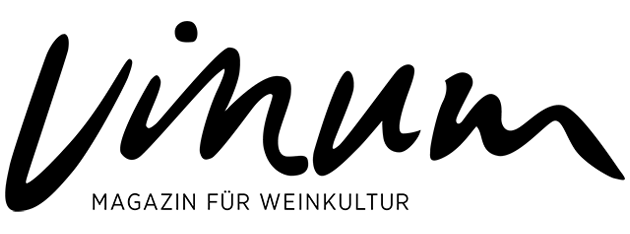Der richtige Augenblick
30 Jahre (Wein)Fotografie
Text und Fotos: Rolf Bichsel

Wir werden von Bildern überflutet, doch niemand lehrt uns deren Sprache. Das ist auch in einer Weinzeitschrift nicht anders. Dabei ist alles so einfach. Wir müssen nur wieder schauen lernen.
Gedanken zu 30 Jahren (Wein)Fotografie
Gibt es Wein-Fotografen? Natürlich nicht. Es gibt Fotografen. Die spezialisieren sich allenfalls auf eine Materie. Ich selber wurde allerdings durch den Wein zum Fotografen. Auf Umwegen und quasi gezwungenermassen. Die erste Kamera, eine simple Kodak, hielt ich mit sechs Jahren in den Händen. Und wie allen Kindern wurde mir «ein gutes Auge» attestiert (weil Erwachsene vergessen, was Hinschauen heisst und weil ich es schaffte, die Sonne im Rücken zu halten und nicht gleich alle Füsse abzuschneiden). Nicht viel später erhielt ich meine erste Videokamera (und eine Gitarre). Ab diesem Moment wollte ich, exakt in der Reihenfolge, rasender Reporter, Autor, Filmemacher und Rockmusiker werden und nie mehr etwas anderes. Fast alles hat sich verwirklicht, auf die eine oder andere Weise. In der Mittelschule kümmerte ich mich um das Fotolabor, baute meine eigene Kamera und sah mich schon als den neuen Hamilton, Doisneau oder Brassaï. Natürlich fotografierte ich in Schwarzweiss und ausschliesslich neblige Landschaften (dort, wo ich aufgewachsen bin, war das ziemlich einfach) und blonde Mädchenköpfe kurz vor Sonnenuntergang. Alles schien zum Besten zu stehen in der besten aller Welten, als es zu einer schicksalhaften Begegnung kam. Ich lief einem ziemlich faulen, aber sehr sympathischen American Native über den Weg, der mit America fast alles und mit Native fast nichts am Hut hatte und mir dennoch mit gespieltem Ernst beibrachte: «Meine Vorfahren sagen: Wenn du etwas knipst, stiehlst du ihm die Seele.» Der Satz schlug ein wie der Blitz. Ich schwor mir, nie wieder eine Kamera anzurühren, studierte stattdessen Musik und begann zu schreiben. Doch eines schönen Tages drückte mir der Herausgeber einer nebulösen Weinzeitschrift mit Sitz in Zürich, für die ich eigentlich nur so nebenbei arbeiten wollte, eine Nikon mit 35-70-Zoom in die Hand und sagte: «So, jetzt bist du auch Fotograf.»

Ich wurde zum Weinknipser wider Willen, zum Thomas Lieven der Weinfotografie. Meinem Eid blieb ich wenigstens so weit treu, dass ich immer, kurz bevor ich den Auslöser drückte, die Augen schloss und sie erst wieder öffnete, wenn das Bild im Kasten war. Doch weil ein Bild mehr sagt als tausend Worte, ich unterdessen zum Zeitschriftenmacher ernannt worden war, das Bild zwei Drittel meiner Tätigkeit ausmachte und mich das Resultat meiner Blindfotografie nicht eben befriedigte, letztlich auch noch die digitale Revolution ausbrach, die zusätzlich verkomplizierte, was ich bis anhin mit ein paar Tricks und viel schlechtem Willen geradeso meisterte, beschloss ich eines Tages, von Grund auf einen ganz neuen Beruf zu lernen. Mein erster Lehrmeister in Sachen Fotografie öffnete mir schon mal die Augen. Echt wie im übertragenen Sinn. Er liess mich gar nicht erst an die Kamera, sondern sagte: «Du schärfst jetzt erst einmal deinen Blick.» So übte ich fleissig schauen und machte mich auf die Suche nach dem heiligen Gral, dem idealen Bild. Natürlich brauchte es dafür auch ein paar (foto-)technische Voraussetzungen. Doch die sind so einfach, dass sie jedes Kind versteht. Gut, mit dem Aufkommen der Digitalfotografie hat sich das etwas geändert. Da muss man nicht nur Objektive mit ihren Brennweiten in- und auswendig kennen, sondern auch moderne Kameras verstehen, die ungeheure Möglichkeiten bieten und erst noch laufend Updates erhalten. Zu analogen Zeiten war das einfacher. Bestimmte (gewiss nach viel visueller Vorarbeit und einigen fototechnischen Entscheidungen) der Druck auf den Auslöser fast definitiv über das endgültige Resultat, ist der so entscheidende Moment (l’instant décisif gemäss Henri CartierBresson) nur eine Etappe auf dem Weg zum idealen Bild. Fotografieren im alten Sinn hat der Akquise von Inhalten Platz gemacht.

Ein guter Fotograf muss heute jeden Schritt der Postproduktion beherrschen, sich mit Farblehre auseinandersetzen, mit Dingen wie Teint, Kontrast, Schärfen, Auflösung oder Korn. Doch hilft dabei nicht die Automatik? Davon lasse ich die Finger. Statt mich in Programmen zu verlieren, wende ich das – logische, einfache, jedem zugängliche – Zusammenspiel von Lichtempfindlichkeit, Blende und Verschlusszeit an. Zuverlässige Lichtmesser hatten schon analoge Fotoapparate, und bei digitalen kann man das Resultat nach einem Blick auf das Display beim nächsten Schuss nachkorrigieren. Ich will selber darüber entscheiden können, was ich falsch mache, statt mir die «richtig» belichtete Szene vom Bordcomputer aufdrängen zu lassen. Der mag dabei helfen, darf assistieren, aber diktieren soll er nicht. Oft bringen gerade vermeintliche «Fehler» eine Aufnahme zum Sprechen. Denn noch einmal: Ein gutes Bild beginnt nicht mit dem Beherrschen der Technik. Es beginnt damit, hinsehen zu lernen. Das gilt nicht nur für den Fotografen, sondern auch für den Bilderkonsumenten. Genau daran hapert es in unserer ach so bildlastigen Welt. Wir knipsen wild in der Gegend herum, betrachten die Umwelt nur mehr durch das Handydisplay und sehen nicht, was wir sehen könnten, sondern was die Entwickler von Handys uns sehen lassen wollen: eine zweidimensionale, saturierte und zu kontrastreiche Karikatur, mit der wir die Wirklichkeit ersetzen, bis die ganze Vorstellungskraft zum Teufel geht. Fotografie, so wie ich sie verstehe und betreibe, nach Jahrzehnten des Studierens und Weiterlernens, das nie ein Ende nimmt, dient nicht dazu, die Wirklichkeit abzubilden.
Ich bin kein Kriegsberichterstatter und dokumentiere auch nicht das Zeitgeschehen. Meine Bilder sind Mittel, Geschichten zu stricken, gemeinsam mit anderen wie Titel, Text, Auszeichnung oder Legende. Kunst ist eine Lüge, die die Wahrheit erzählt, meinte Picasso. Ein gutes Bild auch. So wie Picasso mit Fettstiften und Farbtöpfen gehe ich mit Stilmitteln um, die mir zur Verfügung stehen. Konkreten wie Licht und Schatten, Form und Farbe, Unschärfe und Schärfe oder abstrakten wie Komposition und Proportion, Spannung und Überraschung, Erzeugen von Emotion. Wer mit Fotografieren beginnt, wird mit der Kamera vor der Nase durch die Welt wandern und will den idealen Schnappschuss im Sucher finden. Doch da ist er nicht. Er ist draussen in der Welt. Ich kratze mich auch nicht, bevor es mich juckt. Erst wenn die gute Szene zu «sehen» ist, in natura, vor dem inneren Auge, auf einem Stück Papier oder einem Tablett vorskizziert, reisse ich die Kamera aus dem Holster. Es gibt eine gute Übung dazu: Fotojagd ohne Memorycard. Das Bild bleibt so nur ein paar Sekunden auf dem Display und verschwindet dann auf Nimmerwiedersehen. Wir müssen es uns einprägen, wollen wir es erhalten. Fotografie hat den Eingang ins Museum geschafft. Doch Bildsprache kommt vielen Menschen Spanisch vor. Wir lernen alle möglichen Dinge in der Schule und im Leben, doch Schauen lernen wir nicht. (Wein-) Journalisten werden auf Weingütern wie der Messias empfangen. Fotografen sagt man dagegen kaum guten Tag. Dabei kann der dreimal mehr als ein selbst ernannter Weinpapst und ist zehnmal wichtiger. Ich gebe mich nie als der Profialkoholiker zu erkennen, der ich leider auch bin, sondern sage immer trotzig: Ich bin nur der Fotograf, selbst wenn ich mich dann mit einem Glas Wasser zufriedengeben muss. Als Hommage an meine Berufskollegen, als Gradmesser für den Charakter meines Sujets. Wer etwas von Grund auf lernen will, braucht gute Vorbilder. Für mich waren das ein paar grosse Fotografen. Der Pionier Gustave le Gray etwa (1820 bis 1884), der vermittelt, dass Fotografie von allem Anfang an Ausdrucksmittel war und nicht nur Zeitdokumentation, Robert Frank, Werner Bischof, Irving Penn. Guy Bourdin, wie Helmut Newton ein Stilist des Überraschungsmomentes. Er bezeichnete sich als Image Maker (Bildermacher). Das gefällt mir.
Das grösste Problem der Fotografie: Sie scheint vier Dimensionen auf zwei zu reduzieren. Film tut dies auch. Doch Bewegung vermittelt Eindruck von Zeit und Raum. Fotografie schafft das mit dem Spiel von Schärfe und Unschärfe, wie es jede Kamerabroschüre lehrt. Das Wasser, das aus einem Brunnenrohr plätschert, mit langer Verschlusszeit fotografiert, zeigt Bewegungsunschärfe und vermittelt ein Gefühl verflossener Zeit. Ist etwa in einem Porträtbild alles scharf, vom Vordergrund bis zum Hintergrund, wirkt dieses flach und zweidimensional. Die weit geöffnete Blende, die für ein bisschen Tiefenschärfe sorgt, verhindert dies. Das Sujet steht im Raum und konzentriert den Blick auf sich. (Was bei der Anwendung immer wieder zu Kommentaren führt wie: Warum ist das Etikett meiner Flasche nicht scharf? Antwort: Weil es hier um dich geht, nicht um die Flasche, und jeder seriöse Fotograf das Auge des Betrachters auf das Sujet lenkt. Davon gleich mehr.) Für Tiefe im Bild und Eindruck von Raum sorgen Diagonalen – ganz im Gegensatz zu parallelen Linien. Einer der vielen Fehler, die ich lange machte. Ich fotografierte ausschliesslich mit Teleobjektiv, schraubte einfach so lange an dem Ding herum, bis alles Platz hatte, was ich im Bild haben wollte, und lernte so nie, was Brennweite bedeutet und wie sie sich auf das fertige Bild auswirkt. Verzerrungen bei der Weitwinkelfotografie nahm ich als gottgegeben hin und bemerkte sie bald nicht mehr. Heute bleiben die Zooms oft im Fotokoffer. Selbst wenn ich damit arbeite, etwa bei Landschaftsaufnahmen, wähle ich die Brennweite, bevor ich die Kamera ans Auge halte. Doch meist arbeite ich mit Festbrennweiten. Den Bildausschnitt bestimme ich, indem ich ein paar Schritte vorwärts oder rückwärts gehe. Das hat im Übrigen nichts mit Kreativität zu tun (auch in Sachen Fotografie ein arg strapazierter Ausdruck: Schwarzweiss ist kreativ, Unschärfe ist kreativ... ein gelungenes, ausgewogenes Bild hingegen unkreativ, kitschig oder kommerziell. Pustekuchen!).
Ein gutes Bild sagt mehr als tausend Worte. Und wie Worte erzählt es eine Geschichte, erst recht in einer Zeitschrift. Eine Geschichte, nicht zwei oder 20! Bilder, in denen es von unwesentlichen Details nur so wimmelt, lenken den Betrachter von der eigentlichen Aussage ab, die – weil sie nicht mit Worten erfolgt und wie hier mit langatmigen Erläuterungen, sondern mit Form, Farbe, Komposition – eindeutig sein soll und verständlich, so verständlich, dass es keine lange Bildlegende braucht, die vorab über das Wo und Wer Auskunft gibt und die Verbindung zum eigentlichen Text herstellen soll. Ich scheue mich nicht, Details, die den Betrachter von der Essenz ablenken, brutal auszuradieren, so wie das russische Retuscheure unter Stalin auf offiziellen Bildern mit hinterrücks eliminierten Politbüromitgliedern taten. Retuschieren ist eine alte Technik. Bilder werden bearbeitet, seit man überhaupt Bilder schiesst. Retusche ist nicht Fälschung, sondern Wahrheit. (Picasso!) Soll der Leser die Geschichte mitkriegen, die ein Bild erzählt, muss er die Bildsprache verstehen. Er tut dies instinktiv. Doch etwas Hilfe schadet gewiss dabei nicht.
Nun ist mein Sujet seit 30 Jahren der Wein und sein Umfeld. Das mag einschränkend wirken. Keine Frage: Rebberge sind nicht immer sexy. Vor vielen Jahren beauftragten wir einen Starfotografen damit, die Rebberge der Toskana abzulichten. Das Resultat war in der Tat langweilig. In Weinkellern stehen im besten Fall romantisch anmutende Fässer, aber manchmal auch vergammelte Tanks aus Kunstharz. Weinmacher verstehen sich auf ihr Metier: Aber als Fotomodell eignen sie sich nicht immer. Doch genau das macht die Sache spannend. Auf den nächsten Seiten folgen Beispiele aus meiner Sammlung der letzten 20 Jahre. Kein «Best-of», sondern Bilder, die Aussagen illustrieren und Geschichten erzählen. Das Sujet ist Wein – doch das ist nur ein Vorwand. Wein ist ein Prisma, an dem die Welt sich bricht.
Menschen
Das Erste, was Sujets tun, wenn ich sie ablichten will: Sie stellen sich vor eine Wand, als wäre ich ein Erschiessungskommando. Ich suche im Gegenteil nach einem weit entfernten oder möglichst neutralen Hintergrund oder verwende eine Decke: Irwing Penn schleppte während seiner ganzen Karriere einen alten Theatervorhang mit, vor dem er brillant Sujets fotografierte. Dann stehen Leute, die keine Mannequinschule absolviert haben, verkrampft parallel zur Kamera, schauen ins Objektiv und lächeln verlegen. Jahrelang fotografierte ich sie daher während des Gesprächs mit meiner Mitarbeiterin. Es brauchte dabei oft mehrere Filmrollen und später einigen Speicherplatz, um nur ein einziges brauchbares Bild hinzukriegen. Heute fehlt mir die Geduld dazu, darum führe ich Leute ziemlich konsequent. Selbst im Freien verwende ich fast immer weiches Blitzlicht. Das menschliche Hirn integriert ein hervorragendes Bildkorrekturprogramm, das etwa um Weissabgleich, Proportionskorrekturen, Lichtausgleich besorgt ist, doch es funktioniert nur in natura. Auf dem Bild ist das Sache des Fotografen. Ich möchte, dass der Leser Sympathie für ein Sujet empfindet, ich beobachte Leute, merke mir Körpersprache, Ausdruck, Proportionen, versuche, ihren Charakter wiederzugeben, nachdenklich, in sich gekehrt, originell, überraschend.
Architektur
Alte Weinschlösser und moderne Kelteranlagen sind attraktive Sujets, doch sie stehen leider im Freien, morgens und abends stören lange Schatten, Bäume verdecken die Sicht, da fehlt mitunter der Raum, um die richtige Perspektive zu finden. Ich stehe unten und blicke nach oben, muss mit dem Weitwinkel arbeiten, was zu unschönen Verformungen führt. Bildbearbeitungsprogramme helfen, sie wenigstens teilweise zu korrigieren, die Drohne ermöglicht den waagrechten Blick. Das optimale Licht für Fassaden herrscht je nach Jahreszeit in der zweiten Hälfte des Morgens, wenn die Schatten relativ kurz ausfallen.
Auch Keller sind interessant oder romantisch, doch selten gut ausgeleuchtet. Man muss mit vorhandenem Licht arbeiten, will man nicht Stunden damit verbringen, den Keller richtig auszuleuchten, und ein Stativ verwenden, um lange belichten zu können, sowie höhere Isozahlen oder einen Stabilisator. Statt den Weissabgleich auf Automatik zu stellen, lasse ich die Kamera auf 5600 Kelvin (Tageslicht) und spiele genau mit dem Colorcast (der Farbdominanz, Rot, Blau, Neongrün, Gold), der dabei entsteht. Barriques ruhen in Linien, die gute Diagonalen bilden. Als Stilmittel eingesetzt, führt die Weitwinkelverzerrung zu interessanten Effekten. Keller sind voller interessanter Details. Treppen mag ich besonders.
Landschaft
Ziel eines guten Landschaftsbildes: den Leser zu ermuntern, selber dort hinzureisen. Doch gerade Reben sind nicht einfach zu fotografieren. Entweder sind Rebberge flach, und man sieht nur die erste Reihe. Oder man steht unten am Rebhügel, der dann wie eine Wand aufsteigt. Einzige Möglichkeit: Höhe gewinnen, um einen möglichst weiten Ausblick zu geniessen. Ich bin – doch keine Regel ohne Ausnahme – kein besonderer Fan von Sonnenauf- und -untergängen. Solche lichte ich nur ab, wenn es sich wirklich lohnt. Doch im Hochsommer zwischen 11.00 und 17.00 Uhr gelingt selten ein gutes Landschaftsbild. Die beste Zeit ist da schon morgens und abends. Von Herbst bis Frühjahr ist das einfacher. Da nutzt man fast den ganzen Tag. Ich fahre allerdings auch dann nicht wild in der Gegend herum, stürze aus dem Wagen und schiesse auf alles, was sich nicht bewegt. Ich suche mittels Karten und Leuten, die eine Gegend kennen, genau in den Stunden, in denen kein gutes Licht herrscht, nach Orten, die einen besonderen Blick erlauben. Die Kamera bleibt im Auto, eine Software hält Sonnenstand und Koordinaten fest.
Zum geeigneten Zeitpunkt suche ich diesen Ort auf und verweile dort mindestens eine halbe Stunde. Bei schwierigem Licht kann das viel länger dauern: Licht ist der Schlüssel zu Landschaftsfotografie. Ich mag Wolken. Doch ein wolkenlos blauer Himmel ist besser als ein tiefgrauer ohne Lichtblick. In eintönigen Reblandschaften suche ich nach Strukturen (Wellen, Linien, Diagonalen) und einem Sujet, an dem der Betrachter sich festhalten kann: einem Baum, einer Hütte, einem Turm. Fotografiere ich Reben mit dem Licht, wirken sie oft flach und farblos. Die erste Reihe wirft Schatten auf die nächste. Ist der Boden zwischen den Rebzeilen nicht begrünt, wirkt er oft grell und steht unangenehm im Kontrast zum dunklen Grün der Rebe. Ich fotografiere Reben daher oft mit leichtem oder vollem Gegenlicht. In der Postproduktion korrigiere ich darauf den Unterschied zwischen dem zu hellen Himmel und den zu dunklen Rebzeilen, um wieder das Bild zu erreichen, das ich vor den Augen hatte. Wasser spiegelt das Licht des Himmels wider. Flüsse, Brücken, Seen sind besonders lohnenswerte Sujets.